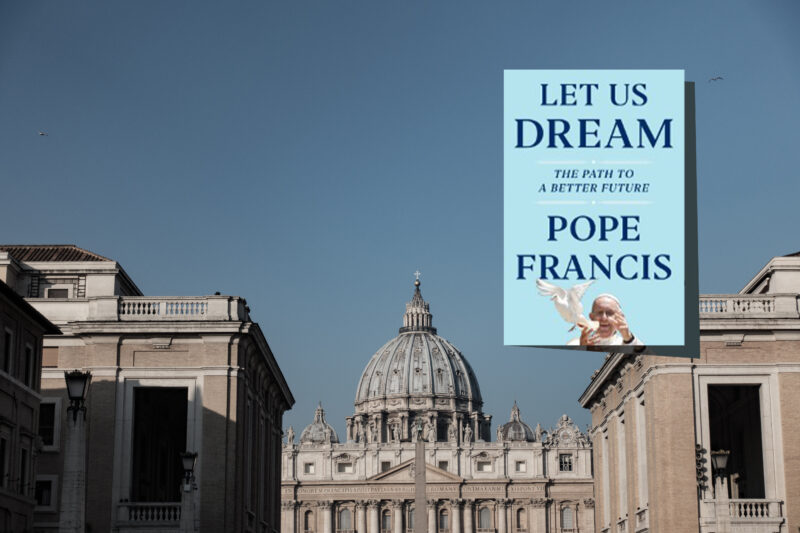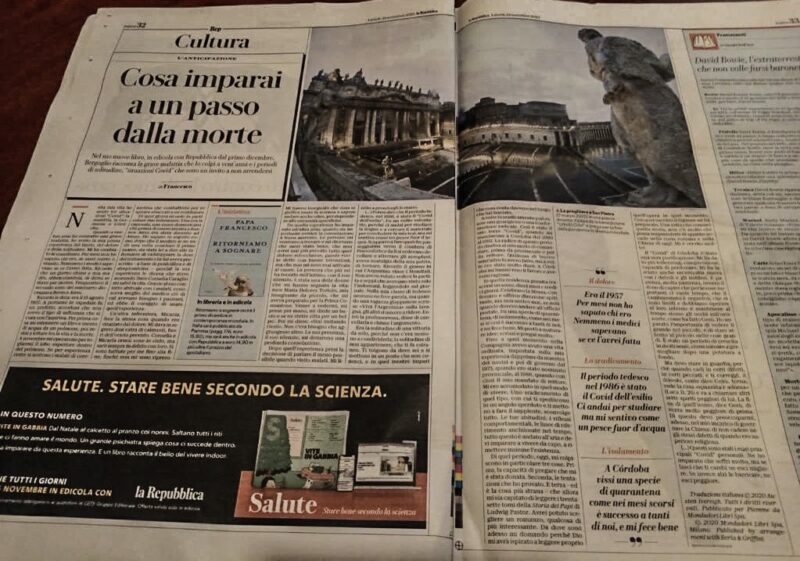Wenn man die Augen schließt und vergisst, wo Papst Franziskus gerade war, dann waren es vertraute Worte. „Die Waffen sollen schweigen“, „Man lasse die Friedensstifter, die Gestalter des Friedens zu Wort kommen!“, es ist „notwendig, Gerechtigkeit aufzubauen, für mehr Ehrlichkeit und Transparenz zu sorgen und die hierfür übergeordneten Institutionen zu stärken.“
Das sind Worte aus dem Irak, aber wenn man böse ist könnte man sagen, dass sie hinreichend allgemein sind, so dass sie überall hin passen. Da fand ich es erstaunlich, dass die Medien in unseren Ländern hier der Reise so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, im Vorfeld genauso wie währenddessen. Das ist bei Papstreisen längst nicht mehr normal.
Vertraute Worte
Es stimmt, die Worte waren vertraut, und das nicht nur deswegen, weil die päpstlichen Redenschreiber gerne Eigenzitate einbauen. Gleich ob Papstbuch oder verschiedene Grundsatzreden bei anderen Reisen, Ton und Wortwahl haben wir schon oft gehört.
Aber ist das ein Nachteil? Ich habe mich über mich selber geärgert, weil meine erste Reaktion genau diese war: schon mal gehört, nicht neu. Geärgert habe ich mich, weil beim Nachdenken auffällt, dass der Papst mittlerweile der Einzige ist, der die Probleme von Krieg, Vertreibung und Religionskonflikten nicht bei Konferenzen, sondern durch Reisen markiert. Er ist vor Ort, er trifft Menschen. Und zeigt, dass diese so oft gehörten Worte eben passen. Leider an zu vielen Orten.
Während wir uns um uns selber drehen
Es muss halt immer wieder gesagt werden. Vor allem während unserer Corona-Krise, wo wie hier allzu sehr um uns selber drehen und die Probleme etwa im Nahen Osten verdrängen. Der Krieg in Syrien kommt nicht mehr vor, Libyen auch nicht, der Irak war bis zur Papstreise fast vergessen.
Papst Franziskus war vor der Reise kritisiert worden, er riskiere zu viel, vor allem das Leben der Menschen, die ungeschützt dem Virus ausgesetzt würden und so weiter.
Neue Aktualität
Stattdessen haben wir etwa in Karakosch Erzählungen von Menschen gehört, die das, was wir so leicht vergessen, erlebt haben. Und die Papstworte, so vertraut sie auch klingen mögen, bekommen vor Ort neue Aktualität.
Und wenn man wirklich zuhört, dann beschleicht einen die Einsicht: wir können es nicht oft genug hören.