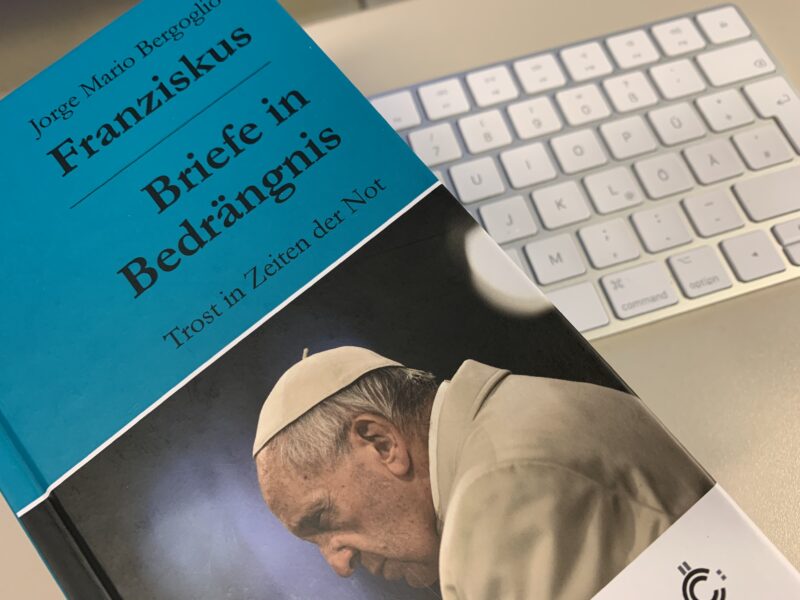Man kann es mit einem Kopfschütteln wegschweigen. Man kann es als Argument für nicht satisfaktionsfähig halten und ignorieren. Man kann die Beleidigung, die drin steckt, erkennen und deswegen nicht darauf eingehen. Aber davon geht es nicht weg: die Aufforderung an Katholikinnen und Katholiken, doch bitte die katholische Kirche zu verlassen. Geht zu den Protestanten! Hilflos vielleicht, aber häufiger gehört als der Debatte lieb sein kann.
Seit ich selber im Synodalen Weg aktiv bin, kommt diese Aufforderung noch häufiger als davor. Bis dato war sie Papst Franziskus und seinem Anliegen einer Kirche der Umkehr vorbehalten, jetzt kommt es regelmäßig mit Bezug auf die Kirche bei uns daher.
Geht zu den Protestanten!
Ein Zitat aus der jüngsten Email, die mich dazu erreicht hat (anonymisiert):
„Da frage ich mich, warum gehen Sie nicht einfach zu den Protestanten? Dort finden Sie alles was Sie begehren! Dort finden Sie bestimmt Ihr Glück! Warum spalten Sie, ja vernichten Sie meine römisch-apostolische katholische Kirche in Deutschland?“
Das klingt so, wie es ist: hilflos. Da will jemand sich dem Wandel der Kirche nicht aussetzen und will, dass alles bleibt wie es ist. Oder besser: dass alles so wird, wie es durch die Scheuklappen aussieht. Aber dieses Argument gibt es nicht nur in dieser hilflosen Form, der Theologe Karl-Heinz Menke will einen „katholischen Protestantismus” ausgemacht haben.
„Katholischer Protestantismus“?
Zunächst überrascht die Wortwahl. Eigentlich sprechen wir von „katholisch“ und „evangelisch“. Nun aber wird „protestantisch“ gewählt, wohl um den Kontrast zu schärfen. Es geht also gar nicht um Ernst gemeinte Vorschläge (falls das überhaupt jemand je angenommen haben sollte), im Vorschlag steckt Streit.
Das allein reicht aber noch nicht, um dieser Aufforderung den Schleier herunter zu reißen. Da drin steckt noch mehr, und das alles steckt in mehr Köpfen und Herzen, als uns lieb sein kann.
Weiter verbreitet, als gedacht
Erstens: Es geht an der Realität der Kirchen der Reformation vorbei. Aufgegriffen werden Dinge wie die Frauenordination und eine echte parlamentarische Struktur, aber die durch und nach der Reformation entstandenen Kirchen sind ja mehr als das. Sie haben eine eigene geistliche und theologische Tradition. Die Reduktion auf wenige Phänomene geht an der Wirklichkeit vorbei.
Zweitens: Es geht an der Aufgabe der Ökumene vorbei. Seit Jahrzehnten, seit dem Konzil, ist das Streben nach Einheit Teil des katholischen Selbstverständnisses. Das bedeutet nicht, in Kontroversen nicht auch mal auf eigenen Standpunkten zu bestehen, aber grundsätzlich gilt, dass die Ökumene eine Herausforderung ist, die wir annehmen müssen. Und derlei Aufforderungen schaden der Ökumene.
Probleme mit der Wirklichkeit
Drittens: die hier zum Vorschein kommende Hilflosigkeit geht an der Wirklichkeit der Kirche vorbei. Mich erinnert das an den bis in die 80er Jahre gehörten Ruf älterer Westdeutscher an die Jugend, man solle doch in den Osten gehen, wenn es einem hier nicht passe. Dämlich damals schon, ist auch die heutige kirchliche Abwandlung nicht wirklich intelligent. Ein Feindbild (siehe: ‚protestantisch‘ statt ‚evangelisch’) wird angeschärft um damit die Unzulänglichkeiten des eigenen Systems zu kaschieren. Und das eigene Wohlbefinden nicht in Unruhe geraten zu lassen.
Ich darf noch mal aus der oben genannten Email zitieren:
„Ich möchte in Ruhe meinen Glauben in einer Kirche ausüben, die nicht ohne menschlicher Fehler ist, aber so wie sie ist, ist sie immer noch meine Kirche wo ich gerne komme um zu beten – nicht um zu kämpfen.“
Beten, nicht kämpfen?
Allein das „nicht ohne menschliche Fehler“ sollte stutzen lassen. In seiner Allgemeinheit klingt das irgendwie nett, aber wenn wir uns dann erinnern, was diese „menschlichen Fehler“ waren, spätestens dann sollten wir stutzen. Schließlich war eine Studie zum Missbrauch Auslöser des Synodalen Wegs.
Wenn wir jetzt schon etwas sagen können dann doch wohl das, dass es kein zurück gibt zu einer Kirche, wie sie aus den Zeilen des mich anschreibenden Katholiken hervor scheint. Wenn alle Opfer gehört, alle Maßnahmen ergriffen sind. Und wenn wir durch diese Geschichten durch sind und alles richtig gemacht haben sollten, selbst dann wird die Kirche eine andere sein.
Kirche wird eine andere sein
Das Ideal von Kirche wird es nicht mehr geben. Nicht nur weil es zunehmend schwerer wird, vor anderen und auch vor sich selbst zu begründen, weswegen man noch dabei ist. Sondern auch, weil wir einsehen müssen, dass das Sprechen vom Ideal vieles verdeckt und vielleicht sogar möglich gemacht hat, was so gar nicht zum Ideal passt.
Die Kirche ist jetzt schon eine andere. Diese Einsicht ist noch nicht überall gleich verbreitet, um so wichtiger ist, dass wir reden, reden, reden. In theologischen Seminaren und bei Konferenzen. Im Arbeitszimmer des Papstes und bei Bischofskonferenzen. Unter Katholikinnen und Katholiken wie auch ökumenisch.
Sich dem zu verweigern bedeutet eben nicht Treue, sondern den Auftrag zu verfehlen, den Kirche hat.
Auch ich gehe gerne in meine Kirche, um zu beten. Wer bewerten bedeutet nicht, dass alle Konflikte dann draußen bleiben. Beten bedeutet für mich, sich dann auch einzusetzen. Zu streiten, wenn nötig. Die Augen offen zu halten.
Der Versuch, alles Herausfordernde vor die Kirchentüre zu verbannen, hilft niemandem.