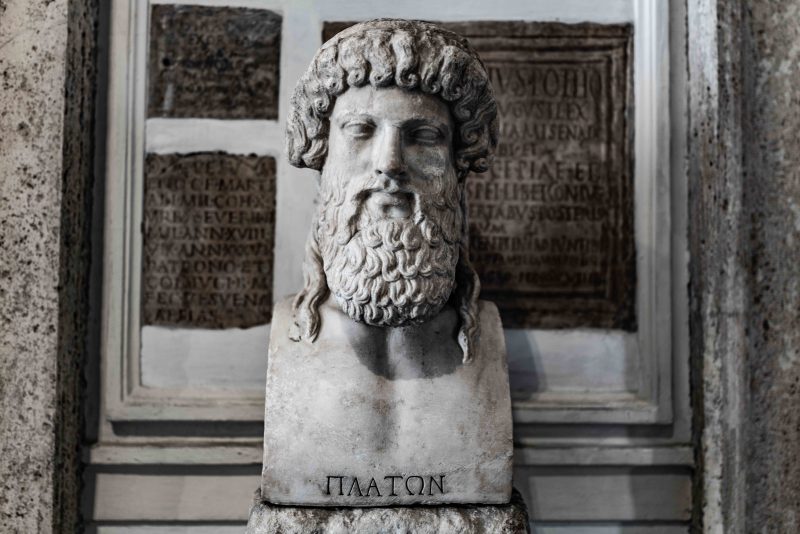Souverän ist anders: völlig aus blauem Himmel kam die Nachricht, dass ein italienischer Kurienmitarbeiter und über Jahre enger Mitarbeiter zweier Päpste seinen Kardinalshut verliert. Angelo Becciù erzählte danach, wie er nichts ahnend auf einmal seine Position in der Kirche verloren habe.
Es ist nicht das erstes Mal, dass Papst Franziskus so reagiert. Die Ablösung von Kardinal Gerhard Ludwig Müller war für diesen ebenfalls eine Überraschung. Und da in Personalentscheidungen keine Begründungen gegeben werden, bleiben Spekulationen. Souverän war das nicht, in beiden Fällen.
Souverän war das nicht
Und was ist mit den anderen?, mag man fragen. Da sind ja einige, über denen die schwarze Wolke einer Anklage hing. Kardinal Barbarin in Frankreich, Kardinal Pell in Australien, beide angeklagt, beide haben ihren Hut behalten.
Und nun polizeiliche Ermittlungen in einem Finanzskandal und schon entscheidet der Papst, ohne dass es zu einem zivilrechtlichen Prozess gekommen ist. Ich nehme an, dass es gute Gründe dafür gibt, die über die Anklage hinaus gehen. Und ich merke, dass ich mit dieser Annahme im Feld der Spekulation lande.
Es bleiben uns nur Spekulationen
Nun muss in Personalfragen nicht alles offengelegt werden, trotzdem entsteht ein merkwürdiges Bild, in dem das Wort „Willkür“ im Hintergrund mitschwingt. Und die Frage, wie in der Kirche eigentlich Autorität ausgeübt wird.
Nicht zu Unrecht spricht ja auch der synodale Weg genau darüber.
Debatte um Autorität in der Kirche
Es ist zu begrüßen, dass Korruption – so es denn welche war – im Vatikan keinen Platz mehr hat. Das war nicht immer so, wie die lange Liste an Skandalen erzählt. Aber dazu gehört auch Transparenz, und die vermisse ich hier. Warum Becciù und nicht Pell oder Barbarin? Liegt das alleine an der empfundenen Wahrheit des Papstes? Oder war da anderes im Spiel? Und wie kann man das klären, außer im Gewissen des Papstes?
Die Geschichte um Erzbischof Becciù zeigt einmal mehr, dass wir in Sachen Autorität in der Kirche Kontrolle brauchen. Transparenz, Verfahren, Nachvollziehbarkeit, Gewaltenteilung. Denn so, wie es hier gelaufen ist, baut das kein Vertrauen auf.