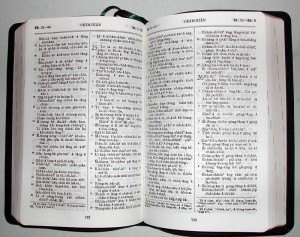Und wieder geht ein großer Sprecher von Gott. Klaus Berger, Exeget, Frager, Schreiber, Sprecher, starb am vergangenen Montag. Unbequem war er und immer eine Bereicherung. Nie um ein Wort verlegen, gerne auch blumig und kantig, so hat er sich jahrelang zu Jesus und Kirche und Theologie geäußert. Gemeinsam mit seiner Frau hat er eine eigene Übersetzung des NT heraus gebracht, in eigener Reihenfolge der Texte und samt der Apokryphen. Da war keine Scheu in ihm, die ihn vor solch einem Werk zurück gehalten hätte.
In den vergangenen Jahren hatte ich mehrfach das Vergnügen, in kleinerem Kreis mit ihm zu tun zu haben. Ein anstrengendes Vergnügen war es, man konnte sich wunderbar an ihm reiben und irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, dass das auch seine Absicht war. Nicht abschauen, nicht ablesen, sondern selber denken.
Ein großer Sprecher von Gott
Dazu verwirrte er gerne. Mit Worten zum Beispiel: „Es herrscht ein bestimmtes Jesusbild vor, dass immer noch den Schlafzimmern des 20. Jahrhunderts entstammt”, so in einem Interview in Rom. Der Jesus, von dem er sprach, war einer, der „wirklich Neues [bringt], was häufig ja verschüttet ist, nicht zuletzt durch die dogmatischen Handbücher, durch die Katechismen und durch die Praxis der Kirchen.“ Und das Neue machte er sichtbar, in dem er das Alte aufrüttelte und durchschüttelte.
Hagenkord: Was würden Sie denn sagen, wie man sich Jesus nähern kann?
Berger: „Indem man anhand von Texten gnadenlos fragt: Wie soll ich das verstehen? Es geht zunächst um das Verstehen eines Fremden, der fremd geworden ist und in anderen Jahrhunderten wahrscheinlich nicht weniger fremd war (..). Es geht um die Begegnung mit einem, der fremd ist und diese Begegnung macht einen schon heiß, wenn man kurz davor ist, etwas davon mit zu bekommen. Es ist wie beim Topfschlagen (…), Theologen können helfen aber die Menschen müssen den entscheidenden Schlag selber machen. Wirkliche Begegnung mit Gott.“
Hagenkord: Bleibt uns der Jesus aber nicht doch auch nach allem Erklären und dann Nachfragen letztlich fremd?
Berger: „Ich finde, dass man jeden Tag gespannt sein darf, was man an genau diesem Tag aus dem Text herausfindet. Das ist bei manchen Texten manchmal ohne Ergebnis, dass man nichts findet, aber meistens ist es doch so, dass man weiter geführt wird, wirklich weiter geführt wird, so dass Jesus nicht fremd bleibt, sondern neue Eigenschaften von sich zeigt. Genau wie meine Frau auch. Meine Frau liebe ich in vergleichbarer Weise, dass ich gespannt bin, was ich heute an ihr entdecken kann.“
Hagenkord: Ruhe und beruhigt sein ist das Gegenteil von Bibellektüre?
Berger: „Ja. Man muss bereit sein, sich überraschen zu lassen und bereit sein, die liebsten Überzeugungen aufzugeben.“
Kirchlich, bildreich, liturgisch
Dabei war Berger immer auch kirchlich. Verwirrend kirchlich, eine Zeit lang wurde eifrigst spekuliert, ob er nun katholisch oder evangelisch sei, Klarheit und kirchliche Eindeutigkeit im Rahmen der Konvention war seine Sache nicht. Und liturgisch war er, da lag seine Bindung an den Orden der Zisterzienser, die ihm wichtig war und die ihn geprägt hat.
Er war ein Mann der Sprache, nicht nur der überlieferten. Seine eigene war bildreich. Ob er nun biblische Theologie mit Geflügelsalat verglich oder in ruhigen aber bestimmten Tönen über die Theologie schimpfte, die Jesus verharmlose. Nicht zuletzt deswegen war es stimmig, dass er sich zuletzt ausführlich dem bildreichsten Buch des Neuen Testamentes gewidmet hat, der Offenbarung des Johannes. „Die Kirche des Wortes lebt in der Welt der Bilder“, so Berger.
Ein großer Sprecher von Gott war er. Und sein unbequemes sprachlich anstrengendes Aufrütteln wird uns fehlen.