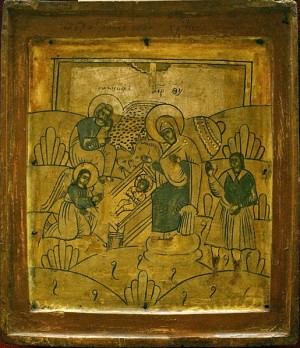„Das wahre Heil des Menschen besteht nicht in Dingen, die er von sich aus erlangen könnte”: Es muss mal wieder gesagt werden. An diesem Donnerstag hat der Vatikan einen Brief veröffentlicht, der von der Glaubenskongregation an alle Bischöfe der Welt geschickt wird, approbiert vom Papst. Und mir scheint dieser Satz (Nr. 6) das Zentrum des Textes zu sein.

Sollte uns das überraschen? Ist das was Neues? Nein, ist es nicht. Aber im Licht all dessen, was Papst Franziskus in den nun fünf Jahren seines Pontifikates immer wieder predigt und lehrt, ist es gut, das einmal systematisiert zu lesen. Und genau das tut der Text.
Der Text buchstabiert zwei Tendenzen des modernen Menschen durch, zwei Moden oder Versuchungen, ganz wie man will, die auch immer wieder vom Papst zitiert werden. Auch das ist so neu nicht, hier im Blog habe ich das auch schon einmal besprochen, ist noch gar nicht so lange her. Es geht um die neo-ismen, den neo-Pelagianismus und den neo-Gnostizismus.
Individualismus und Moderne
Ein Verständnis von Erlösung, das auf dem Einzelnen fußt, auf seinen Kräften und seinem Tun, bleibt individualistisch: das ist der neo-Pelagianismus. Ein Verständnis von Erlösung, das innerlich bleibt, verpasst die Ganzheit des Menschen, die Körperlichkeit, das Geschaffenensein als Mensch in der Welt: das ist der neo-Gnostizismus. Beides – Individualismus und reine Innerlichkeit – führen an Christus vorbei.
Der Text weist darauf hin, dass es hier nicht um alte und antike Häresien geht, die wieder aufgekocht werden, sondern um moderne Tendenzen, die an die alten Versuchungen und Irrwege erinnern. Und so liest der Text die Moderne sozusagen durch diese Brille, er wendet unser Verständnis von Erlösung auf die Umstände und Denkweisen heute an.