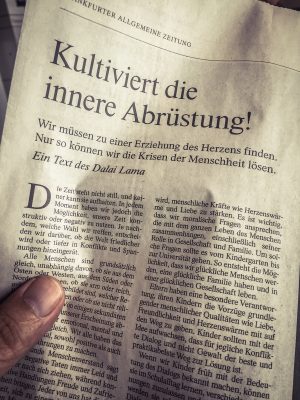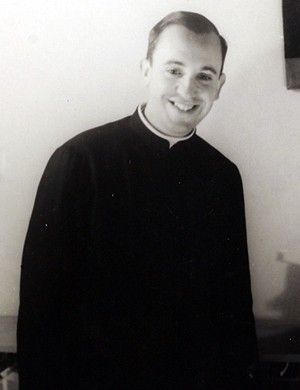„Entscheidung“ oder „Unterscheidung“? Wenn man bei vatican.va, immerhin das offizielle Portal des Vatikan, das Vorbereitungsdokument für die nächste Versammlung der Bischofssynode aufruft, findet man den Titel „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsentscheidung“. Im Text selber findet sich als Titel für die Veranstaltung „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“. Entscheidung oder Unterscheidung, das ist die Frage.
Auf einmal ist er ganz prominent: Der Begriff „Unterscheidung“, vorher nur spirituellen Spezialisten geläufig, wurde von Papst Franziskus ins Zentrum seiner Vorstellung von geistlichem Leben und von Seelsorge gestellt. Unter „Entscheidung“ kann man sich was vorstellen, bei „Unterscheidung“ ist das schon schwieriger.

Bei der Unterscheidung geht es um das, was Karl Rahner einmal als die „Konkretheit und Unableitbarkeit des menschlichen freien Handelns“ genannt hat. Soll heißen: man kann die Entscheidungen des Handelns nicht ins Allgemeine heben, vom allgemein Gültigen her klären, sonst wäre das „Konkrete zu einem bloßen Fall des Allgemeinen“ degradiert. Der Text Rahners stammt übrigens schon aus den 50er Jahren, „Zur Logik der existenziellen Erkenntnis“ ist aber immer noch lesenswert.
Die sich auf Ignatius von Loyola – den Gründer des Jesuitenordens – berufende Tradition will nichts weniger, als den Betenden in Kontakt zu bringen mit dem Willen Gottes. Nicht mit allgemeinen Prinzipien, nicht mir Allaussagen, wie die Logik das nennt. In Rahners eigener und sehr sperriger Sprache (aus einem anderen Artikel): „Diese Wahl aber ist für Ignatius dort (..) nicht einfach die Anwendung allgemeiner menschlicher, christlicher und kirchlicher Normen auf einen Einzelfall, der so nur, wenn vielleicht auch sehr komplex, die Einzelrealisation des Allgemeinen wäre, sondern die Wahl des über alle allgemeinen Normen hinaus je einmalig von Gott Gewollten und Zugeschickten“.
Keine Anwendung allgemeiner Prinzipien
Soll heißen: Eine Wahl – das Ergebnis der Unterscheidung – erfolgt in der Einmaligkeit der Begegnung zwischen Gott und Mensch.
Rahner besteht darauf, dass die Kirche als Handelnde in dem Gebetsprozess nicht vorkommt. Sie ist Rahmen, sie ist Ort, sie ist Vorgabe und Vermittlung, handelt selber aber nicht zwischen Gott und Mensch, wenn es um die Exerzitien und damit um die Unterscheidung geht. Das macht mich nicht zum Herrn über die Kirche, Rahmen und Ort bleiben Rahmen und Ort, es gibt kein „für mich ist …“. Aber es gilt auch die Unmittelbarkeit im Gebet. „Der Wille Gottes ist nicht einfach und restlos vermittelt durch die objektiven Strukturen von Welt, allgemeiner Gültigkeit des Christlichen und der Kirche“, um noch einmal Rahner zu zitieren.
Machen wir ein Beispiel und nehmen den Text, der so gerne und viel debattiert wird, Amoris Laetitia: „Die Geschiedenen in einer neuen Verbindung, zum Beispiel, können sich in sehr unterschiedlichen Situationen befinden, die nicht katalogisiert oder in allzu starre Aussagen eingeschlossen werden dürfen, ohne einer angemessenen persönlichen und pastoralen Unterscheidung Raum zu geben“. „Die Synodenväter haben zum Ausdruck gebracht, dass die Hirten in ihrer Urteilsfindung immer ‚angemessen zu unterscheiden‘ haben, mit einem ‚differenzierten Blick‘ für ‚unterschiedliche Situationen‘. Wir wissen, dass es ‚keine Patentrezepte’ gibt“ (298).
Kein Suchen von Zeichen
Dabei geht es nicht darum, Zeichen zu suchen, die Gott sendet. Das ist ein Missverständnis, das einem häufiger begegnet. Ein Zeichen würde ja die „Wahl“ aufheben, weil sich daraus eine Eindeutigkeit ergäbe. Es geht um Sorgfalt, um Gebet und immer wieder Gebet, es geht um Nuancen und innere Freiheit, es geht um das Handeln Gottes in mir, es geht um Erfahrung und Wahrnehmung.
Das kann Angst auslösen, weil es keine automatisch sich ergebenden Lösungen für Probleme gibt. Ich gebe also eine Situation in einen Entscheidungsgenerator und heraus kommt ein durch Ethik, Moral, Gesetz und Tradition gedecktes Ergebnis. Ohne eigenes Zutun. Genau das ist Unterscheidung eben nicht.