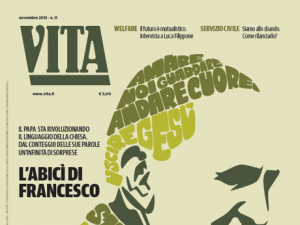Papst Franziskus hat einen ganz eigenen Stil, wenn er spricht. Vielfach wird es wahlweise als direkt, als weniger intellektuell als Benedikt, als pastoral, als lateinamerikanisch oder sonstwie bezeichnet. So ganz kann ich mir noch keinen Reim drauf machen, irgendwie passen die Attribute nicht ganz auf das, was ich täglich höre oder lese. Also versuche ich mich mal an meinen Notizen und Wahrnehmungen. Beginnen will ich Aber mit der klugen Beobachtung eines Mitbruders.

Pater Antonio Spadaro SJ hatte als Chef der Zeitschrift Civiltà Cattolica schon mehrfach Gelegenheit, dem Papst in formloser Atmosphäre zuzuhören. Er hat ihn auch interviewt. Als gelernter Literaturwissenschaftler hat Spadaro auch ein Gespür für Sprache. „Wenn der Papst frei spricht, dann hat seine Sprache einen gewissen Rhythmus, der wellenförmig zunimmt; man muss ihm sorgfältig zuhören, weil er von der lebendigen Beziehung mit seinen Gesprächspartnern lebt. Wer aufmerksam ist, der sollte nicht nur aufmerksam auf den Inhalt hören, sondern auf die Dynamik der Beziehung, die dadurch entsteht,“ so Spadaro in seinem Artikel.
Zirkulär und in Wellenbewegung
Später in seinem Artikel kommt Spadaro immer wieder auf den Stil der Kommunikation zurück, er nennt es die „zirkuläre“ Weise, immer wieder auf Themen zurück zu kommen. Ein Gedanke, der in einer Predigt auftaucht, sagen wir in einer Morgenpredigt, wird in der folgenden öffentlichen Predigt oder Ansprache aufgegriffen, kommt dann nach Wochen noch einmal vor, vielleicht etwas gewandelt und tritt dann zurück.
Man muss diese Linie nicht kennen, um die einzelnen Predigten zu verstehen, aber wenn man den Linien folgt, dann bekommen die einzelnen Gedanken zusätzlich Gestalt. Ein Beispiel? In der Predigt an die Jesuiten sprach er von der Unruhe des Herzens, einige Tage später dann in der Predigt zum Fest Epifanie davon, sich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden zu geben, eine Abwandlung desselben Themas.
Das offensichtlichste Beispiel ist natürlich das Wort Peripherie. Revolutionen entstehen immer dann, wenn man die Welt von der Peripherie aus betrachtet, sagt der Papst. Bethlehem ist die Hütte an der Peripherie Israels, und so weiter. Dieser einzelne Begriff zieht sich durch das gesamte bisherige Pontifikat und er bekommt seinen Inhalt immer von den Orten und Gelegenheiten her, wohin der Papst ihn spricht. Und das färbt dann auch die übrigen Male, die er davon spricht.
Mich erinnert das an das Johannesevangelium, bzw. an mein Studium. Ein Jahr lang haben wir Johannes-Texte übersetzt und da begegnet einem dasselbe Phänomen. Der Evangelist hat einige Worte, die als Anker dienen oder als Wegmarken, von denen man aber genauso nach vorne wie zurück blicken muss. Johanneische Texte sind nicht linear, erst eins dann zwei dann drei, sondern leben von den Beziehungen, die die Worte untereinander haben.
Wir haben damals Listen geführt mit diesen Worten, „Bleiben” zum Beispiel (19 x), „Wahrheit” (26 x), „Glaube(n)” (45 x), „Stunde” (15 x), „ich bin” (19 x). Und so weiter. Das sind Worte, die in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder auftauchen, die aber nicht einfach nur da stehen, sondern aufeinander Bezug nehmen.
Innere Bezüge
Nun ist der Papst kein Evangelist, aber ich fühle mich ermutigt, auch mal kreuz und quer zu lesen, die eine neben die andere Predigt zu halten, „Barmherzigkeit” nicht einfach nur so zu verstehen, sondern immer in Bezug auf das, was er vorher darüber gesagt hat und was er vielleicht später einmal sagen wird.
Es ist schwer zu fassen und vielleicht auch etwas abstrakt, aber wenn Pater Spadaro von der zirkulären Weise des Themensetzens Franziskus’ spricht, dann ist genau das gemeint. Die Dinge lassen sich nicht eins zu eins verstehen, sondern nur in Bezug, also in einer „Begegnung der Worte”.