Ein Mitbruder von mir hält einen Vortrag, in Berlin. Es geht um Flüchtlinge und darum, was der Vatikan und der Papst für eine Perspektive auf diese Frage hat.
Und es passiert, was passieren muss, er bekommt Rückmeldungen. Gute und kritische, soweit, so gut. Leider bekommt er aber auch die üblichen Rückmeldungen: Unterwerfung, realitätsfremd schließlich täten die nur so als ob sie in Gefahr wären und so weiter.

Weil der Mitbruder Kanadier ist zeigt er mir diese Rückmeldungen und fragt, was er antworten soll.
Nichts. Weil die Debatte bereits durch die Anfrage zu ist, kein Raum für Interesse, Bewegung, Austausch. Und bereits die Wortwahl schafft das. Neudeutsch: das “Framing”.
Bekannt wurde der Begriff jetzt vor allem durch das unsägliche Wort des “Asyltourismus”, das der bayerische Ministerpräsident meinte benutzen zu sollen und das so auffällig war, dass es bei Twitter zum Trend wurde. Es wurde benutzt, um die Debatte zu dominieren, noch bevor jemand anders etwas sagt. Und die Twitter-Blase verstärkte das Echo, selbst durch Kritik.
Framing
Auch das Wort von der “Rechtssicherheit” ist auch so ein Framing, als ob wir in den vergangenen Jahren in einer Anarchie gelebt hätten.
Genau das macht auch einer der Emailschreiber: “Hier geht es um Unterwerfung unter den Mohammedanismus, den offensichtlich der Papst und seine Berater wollen.” Die Worte “Unterwerfung” und das Unwort “Mohemmedanismus” lassen gar keine Debatte mehr zu, das Framing ist so stark dass jeder, der sich darauf einlässt, nur noch in Verteidigung steht. Das Land würde durch Flüchtlinge “geflutet” ist auch so ein Beispiel. Die Zahlen zeigen etwas völlig anderes, aber Sinn von Framing ist unter anderem, ohne Verweis auf Realität Debatte zu prägen, färben und zu bestimmen.
Worte haben Gewicht. Es ist nicht dasselbe, ob ich “Kernenergie” oder “Atomkraft” sage, ob “Asylbewerber” oder “Asylanten”. Ich präge bereits die Debatte. Und zwar so, dass ein Argumentieren nachher kaum noch möglich ist. Das ist der Sinn von “Framing”. Die berüchtigten “faulen Griechen” sind so ein Beispiel.
Die Debatte prägen
Es ist ein “Sprechen als ob”. Als ob schon entschieden wäre, was das Ergebnis ist. Als ob die Begriffe nicht schon die Realität schaffen würden, die sie zu beschreiben vorgeben. Als ob es noch eine Offenheit gäbe.
Ein Sprechen als ob, das Realität – Zahlen, Statistiken, ruhiges beraten und austauschen – nicht mehr zulässt.
Was tun?
Erstens: Fragen stellen. Nicht unreflektiert Sprachgebraucht übernehmen. Nein, das ist jetzt kein Plädoyer für politisch korrekte Sprache, das ist ein Plädoyer für Nachdenken, für Vernunft. Also selbst dann, wenn ich begeistert bin, skeptisch werden, wenn solche Framings vorkommen.
Zweitens: Nicht nachsprechen. Nicht alles, was uns von Titelseiten oder aus Politikermund entgegen schallt, ist zur Wiederverwendung geeignet. Die Sprecher wollen etwas von uns, das Kaufen von etwas, das Wählen von etwas. Niemals Thesen einfach wiederholen, auch wenn sie noch so plausibel erscheinen. Meistens erscheinen sie nur.
Drittens: Übersetzen. Ich lebe in Italien, da muss ich all das übersetzen, ins Italienische, wenn ich mich mit meinen Leuten unterhalten will. Das hilft ungemein, verbalen Unfug als solchen zu erkennen. Machen Sie den Versuch: Übersetzen Sie Slogans und Framing in eine Ihnen bekannte Sprache und Sie werden sehen, wie schnell sich herausstellt, was daran alles hakt.
Und dann: eine eigene Sprache finden. Menschlich, christlich, offen für Veränderung, offen für andere Meinungen. Wenn wir die nicht haben, brauchen wir gar nicht erst miteinander zu sprechen.


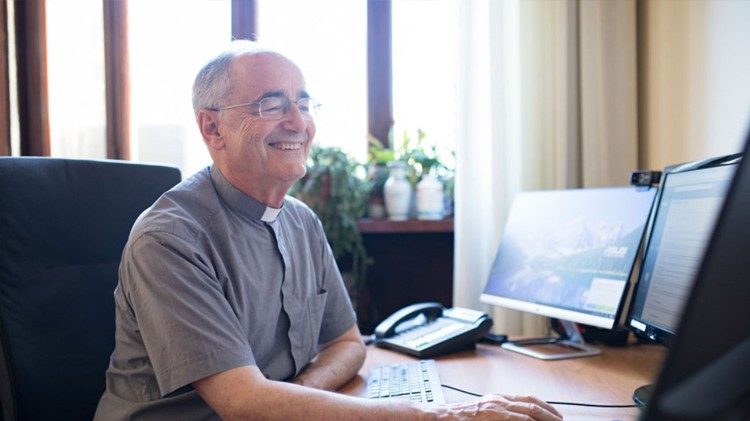
“Worte haben Gewicht. Es ist nicht dasselbe, ob ich “Kernenergie” oder “Atomkraft” sage, ob “Asylbewerber” oder “Asylanten”. Ich präge bereits die Debatte. Und zwar so, dass ein Argumentieren nachher kaum noch möglich ist. Das ist der Sinn von “Framing”. Die berüchtigten “faulen Griechen” sind so ein Beispiel.”
Völlig richtig.
Nur ist eines zu bedenken:
Während man bei Profis wie Politikern und auch Journalisten davon ausgehen muss, dass bewusst “Framing” betrieben wird, gilt das nicht für jedermann.
Wenn Söder Asyltourismus sagt oder wenn Politiker/Journalisten alle hier ankommenden Migranten als Flüchtlinge bezeichnen, liegt wohl meist beabsichtigtes Framing vor (nach Umfragen unter Migranten sind aber nicht alle sondern eher 70% Flüchtlinge http://www.sueddeutsche.de/politik/migranten-flucht-vor-dem-krieg-suche-nach-demokratie-1.3250826 , womit es eben auch Framing ist, alle Flüchtlinge zu nennen und damit die mutmasslich 30% nicht-Flüchtlinge unter den Tisch fallen zu lassen).
Wenn aber irgendein jedermann von “Unterwerfung” oder “Überflutung” oder ähnliches spricht, dann liegt womöglich kein absichtliches Framing vor; sondern derjenige meint es vielleichgt schlicht ernst und ist ggf. sozusagen einem Framing auf dem Leim gegangen.
Und dann kann es auch solche geben, die meinen tatsächlich gute Gründe frü die Wortwahl zu haben; z.b. der Schriftsteller Houellebecq hat ja “Unterwerfung” sogar als Buchtitel gewählt; das ist natürlich auch Framing; aber er meint es soweit ich sehe auch so; also dass “Unterwerfung” kein die Realität verdrehendes Framing ist, sondern ein provokativer aber nicht unangemessener Begriff.