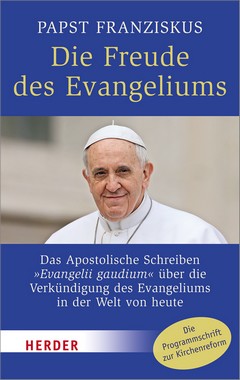Der Vorname Stefan ist keine Vorbedingung für das Bischofsamt. Auch wenn alle drei bisher von Papst Franziskus in Deutschland ernannten Bischöfe – von den „Verschiebungen“ mal abgesehen, Stefan heißen, dürfen wir sicher sein, dass das nur ein Zufall ist. Heße (Hamburg), Burger (Freiburg) und Oster (Passau) sind die Stefans-Bischöfe (oder Stephan, je nachdem). Blicken wir nach Österreich können alle Nicht-Stefans aufatmen: Benno, Werner und Wilhelm heißen die dort ernannten Ortsbischöfe (Elbs, Freistetter bzw. Krautwaschl).
Warum das wichtig sein soll? Weil mit Aachen und Dresden/Meißen bereits zwei Bistümer vakant sind, weil Mainz und Sankt Pölten bereits über das Rücktrittsalter von 75 hinaus sind, Kardinal Lehmann wird bereits 80. Und weil sich auch Würzburg und Hildesheim der Grenze von 75 nähern. Außerdem ist da noch Limburg zu besetzen, also ein ganze Reihe von Bischofsstühlen.
Wenn also Stefan keine Kategorie ist, wonach ernennt dann der Papst? Was sind seine Vorstellungen vom Amt, die ja doch gewissen Einfluss haben?
Der Vollständigkeit halber: Einfluss haben auch die Konkordate, also die Verträge zwischen den einzelnen Ländern und dem Heiligen Stuhl, Einfluss hat auch die die Ernennungen vorbereitende Bischofskongregation in Rom, der Vorsitzende der jeweiligen Bischofskonferenz und natürlich der das Verfahren vor Ort organisierende Nuntius. Aber die agieren fallweise, der Papst hat grundsätzliche Vorstellungen. Und die zählen.

Was das für Vorstellungen sind, wird er nicht müde vorzubringen. Keine Papstreise, bei der er nicht der dort versammelten Bischofskonferenz sagt, was er zu sagen hat. Und wenn man die drei Jahre zurück blickt, sind es eher deutliche Worte, die er bei diesen Gelegenheiten findet. Sehr deutliche sogar, es sind die Klartext-Ansprachen der Reise.
So sehr, dass es jetzt nach der Mexiko-Reise einen kleinen Eklat gegeben hat, eine Publikation des Erzbistums Mexiko-Stadt hat im Editorial mit Bezug auf die Papstrede dort gefragt, wer eigentlich den Papst berate, dass dieser so Falsches über das Land und die Bischöfe sage. Da gab es Einiges an Unruhe.
Wenn er vor den Bischöfen spricht, dann ist das meistens die Übersetzung seiner Vorstellung von Kirche in die pastorale Wirklichkeit eines Landes, und das wie gesagt gerne in aller Deutlichkeit, die von Versuchungen dergleichen spricht, wie der Papst das gerne tut.
Männer ohne „Prinzen-Psychologie“
Ein Beispiel gefällig? Nehmen wir die erste dieser Bischofs-Ansprachen, die in Rio de Janeiro vor den versammelten Bischöfen des Koordinationsrates der CELAM, also der Bischofskonferenzen des Kontinents: „Derjenige, der die Pastoral (…) leitet, ist der Bischof. Der Bischof muss leiten, was nicht dasselbe ist wie sich als Herr aufzuspielen. (… ) Die Bischöfe müssen Hirten sein, nahe am Volk, Väter und Brüder, mit viel Milde; geduldig und barmherzig. Menschen, die die Armut lieben, sowohl die innere Armut als Freiheit vor dem Herrn, als auch die äußere Armut als Einfachheit und Strenge in der persönlichen Lebensführung. Männer, die nicht eine „Prinzen-Psychologie“ besitzen. Männer, die nicht ehrgeizig sind und die Bräutigam einer Kirche sind, ohne nach einer anderen Ausschau zu halten. Männer, die fähig sind, über die ihnen anvertraute Herde zu wachen und sich um alles zu kümmern, was sie zusammenhält: über ihr Volk zu wachen und Acht zu geben auf eventuelle Gefahren, die es bedrohen, doch vor allem, um die Hoffnung zu mehren: dass die Menschen Sonne und Licht im Herzen haben. Männer, die fähig sind, mit Liebe und Geduld die Schritte Gottes in seinem Volk zu unterstützen. Und der Platz, an dem der Bischof bei seinem Volk stehen muss, ist dreifach: entweder vorne, um den Weg anzuzeigen, oder in mitten unter ihnen, um sie geeint zu halten und Auflösungserscheinungen zu neutralisieren, oder auch dahinter, um dafür zu sorgen, dass niemand zurückbleibt, aber auch und grundsätzlich, weil die Herde selbst ihren eigenen Spürsinn hat, um neue Wege zu finden.“

Und dann schließt der Papst an: „Ich möchte nicht ausufern in weiteren Einzelheiten über die Person des Bischofs, sondern schlicht hinzufügen – und dabei mich selber einschließen –, dass wir in Bezug auf die Umkehr in der Pastoral ein wenig in Verzug sind.“
Wie gesagt, das sind verbale Anwendungsbeispiele von pastoralen Vorstellungen. Das ist noch nicht gleich eine Kritik, das ist auch nicht unbedingt ein Maßband, aber dass ist die Vorstellung, nach der Bischöfe sich strecken sollen. Und das ist vielleicht auch die Erwartung der Gläubigen. Weiterlesen “Man nehme … Bischöfe à la Franziskus”