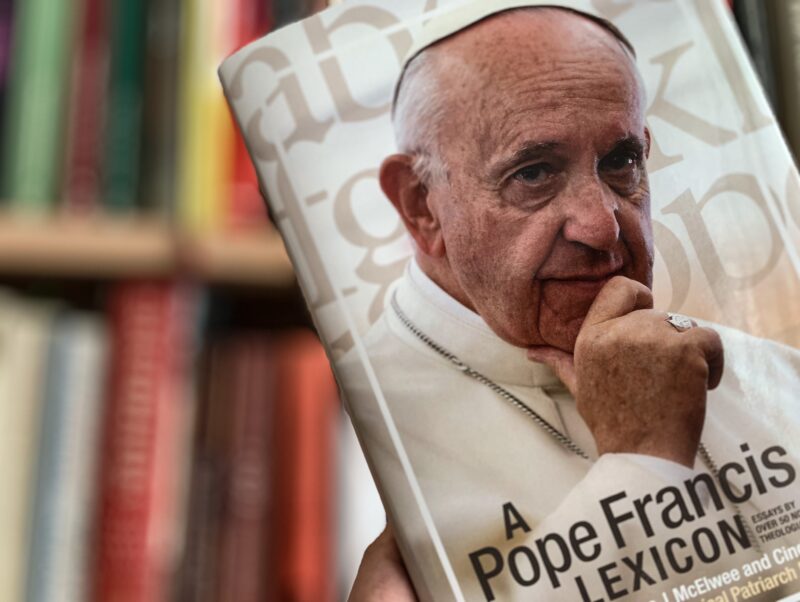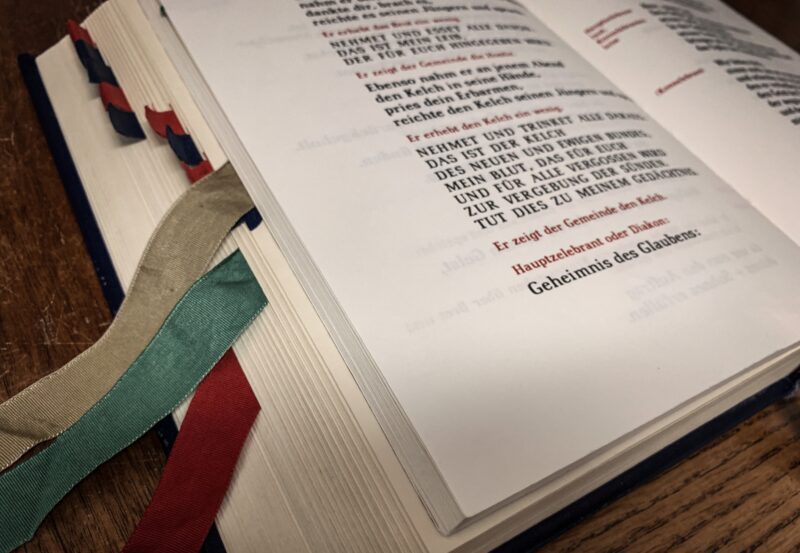Es ist schlimmer, als vorher gesagt. Eine Studie – die so genannte Freiburger Studie – hatte schon ein hartes Licht auf die Realität der Kirchen in Deutschland geworfen. Die jetzt vorgestellten Zahlen zu Kirchenaustritten sagen, dass es 2019 noch viel schlimmer gekommen ist, als gedacht. Und alles vor Corona.
Analysen und Kommentare dazu gibt es viele, und die meisten sind auch richtig. Es gibt eine Aushöhlung des Systems Kirche, es gibt eine brüchig gewordene Bindung und Bindungsbereitschaft, eine schwindende Relevanz von Kirche für das eigene Leben. Und da haben wir das Thema Missbrauch noch nicht einmal angeschnitten.
Zahlen zu Kirchenaustritten
Die Frage ist nun, was daraus folgt. Zahlen sind ja nicht unschuldig, man muss sie lesen.
Mein erster Eindruck ist der eines nüchternen Realismus. Die Kirche von früher, die ist nicht mehr und kommt auch nicht mehr. Und jegliche Reform-Bemühungen, sei es im synodalen Weg oder sonstwo, bringen das nicht zurück. Reform bewahrt nicht, sie schafft für morgen, nicht für heute.
Außerdem ist das ja nicht das erste Mal, dass wir vor solchen Zahlen stehen. Jahr um Jahr schauen wir drauf und werden wieder geschockt, dass es schlimmer ist als gedacht.
Immer wieder schlimmer als gedacht
Was ja auch dazu führt, dass hektische Panik-Rufe ausbleiben. Zu sehr haben wir uns an die Abwärtsbewegung gewöhnt. Und die meisten Katholikinnen und Katholiken, die ich kenne, können all die Austritte gut nachvollziehen.
Mein zweiter Eindruck hat mit der Frage zu tun, was eine Zukunftsperspektive sein kann. Nicht zahlenmäßig, das steht in den Sternen. Nein, was Kirche sein will. Rückzug aufs Kerngeschäft auf der einen Seite oder immer mehr gesellschaftlich relevantes Engagement?
„Wir müssen uns fragen, wie wir Menschen eine Heimat in der Kirche vermitteln können“ steht über dem Artikel zur Kirchenstatistik 2019 auf der Webseite der DBK. Die Frage beantwortet sich eigentlich von selber: die „Heimat Kirche“ ist weg. Kirche ist Option. Eine unter vielen. Und als solche muss sie erleben, dass sich mehr und mehr Menschen gegen sie entscheiden.
Heimat? Welche Heimat?
Das ist also nicht mehr Zukunftsperspektive. Aber was dann? Da stochern wir noch im Nebel. Und die Hoffnung, durch gut ausdiskutierte Papiere beim synodalen Weg daran etwas ändern zu können, wird uns betrügen.
Im Kern wirft uns der Realismus dieser Zahlen zurück auf das Geistliche. Was Kirche ist eben nicht nur unter uns verstehbar. Es entspricht einem gesunden Realismus, hier an dieser Stelle nach Gott zu fragen. Nicht weil Kirche keine Antworten auf Sinnfragen mehr hat, das wäre funktional und das hat die vergangenen Jahrzehnte ja auch schon nicht funktioniert. Sondern weil wir selber vor uns nicht wissen, was Gott mit der Kirche will. Wir haben Phantasien, wir haben vorfabrizierte Antworten, aber all das passt nicht mehr.
Erst wenn wir Kirchen-Verbliebenen wieder lernen, interessiert aneinander von Gott zu sprechen, werden uns die anderen abnehmen, dass es wirklich um Gott geht. In all den Debatten, die wir führen, zu Gerechtigkeit und Schöpfung gfehauso wie zur Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn Gott ins Spiel kommt, dann ist das eine Infragestellung von allem, was wir unter uns ausmachen. Dann ist das mehr als das, was wir selber entscheiden und abwägen. Das möchte ich zu den Zahlen noch einmal deutlich wiederholen.
Die Zahlen von 2019 verweisen uns. Nicht auf uns selber, nicht auf die Sozialstruktur Kirche, auf Relevanz-Verluste und finanzielle Ängste und Engpässe. Sondern auf die Frage, was Gott mit uns zu tun hat. Und das ist kein frommes Ablenken vom Thema, das ist Kern des Problems. In der Kirche von Gott zu sprechen ist Realismus, nicht Eskapismus. Und nur so kommen wir dem auf die Spur, was Kirche in Zukunft sein kann. Ganz gleich, wie groß sie sein wird.