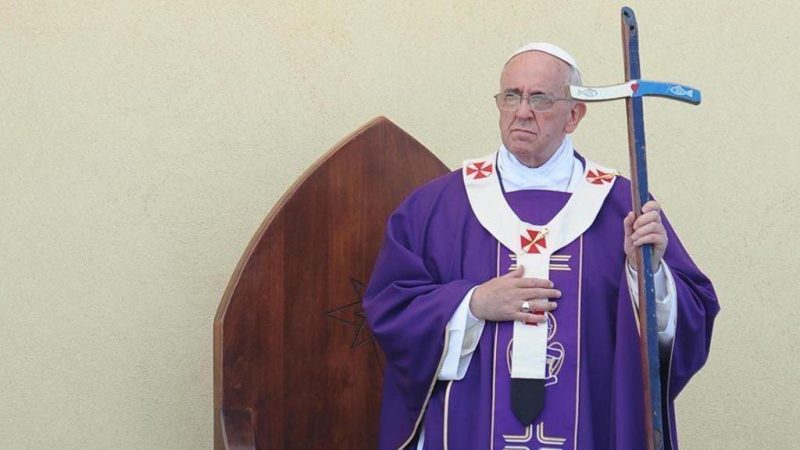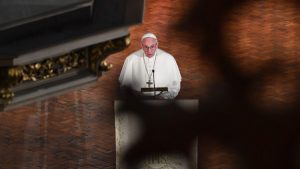Bei den Verhandlungen wäre ich gerne als Beobachter dabei: die Vertreter der Kirchen gehen zu den Landesregierungen und sagen denen, wann sie in Zukunft die Osterferien einzuplanen hätten. Da gäbe es nämlich einige wenige Verschiebungen, wann wir Ostern feiern würde neu bestimmt werden. Und in dieser Frage gibt es Bewegung.
Christinnen und Christen auf der Welt feiern immer noch zu verschiedenen Terminen die Auferstehung. Manchmal fallen die zusammen, manchmal liegen sie Wochen auseinander. Besonders in Jerusalem ist das verwirrend, wenn die einen gerade Auferstehung gefeiert haben und die anderen in die Karwoche einsteigen.
Wann wir Ostern feiern
Der Unterschied betrifft die Ökumene mit den Kirchen der Orthodoxie. Und es scheint ein wenig Bewegung zu geben, zumindest schon einmal in Worten. Schön wäre es, wenn wir diesen irritierenden Punkt, der zwischen den feiernden Gemeinden steht, ausräumen könnten.
Wobei wir aber schon bei den Ferienordnungen von Kantonen und Bundesländern wären: wenn Osterferien wirklich was mit Ostern zu tun haben, dann müssten die Staaten ihre Osterpläne umbauen. Und die Tourismus- und Reise-Wirtschaft auch.
Die Ordnung der Zeit
Sind wir wirklich noch Herr unserer Kalender? Im Allgemeinen nein, die Ordnung unserer Zeit lassen wir uns von anderen Mächten vorgeben. Es ist ein spannendes Gedankenexperiment, sich vorzustellen, dass die Kirchen sich einigen und dann der Staat und die Wirtschaft sich dazu verhalten müssten. Ganz abgesehen davon, dass Kirchen ohne ökumenische Anliegen – einige Freikirchen etwa – auch noch integriert werden wollen. Oder sich dort neue Risse auftun.
Und wenn wir schon mal dabei sind: an Ostern hängen ja auch noch andere Termine, die Fastenzeit und damit der Karneval … .
Wie gesagt, bei den Verhandlungen wäre ich gerne dabei. Mindestens auch deswegen, weil das für uns Glaubende selber einige Fragen aufwirft: wären wir bereit, um der Ökumene Willen diese Auseinandersetzung zu suchen? Wären wir bereit, für den selbstbestimmten Ostertermin einzutreten oder sind wir zufriedener, wenn der Staat das übernimmt?
Allein die Debatte unter uns wäre es wert.