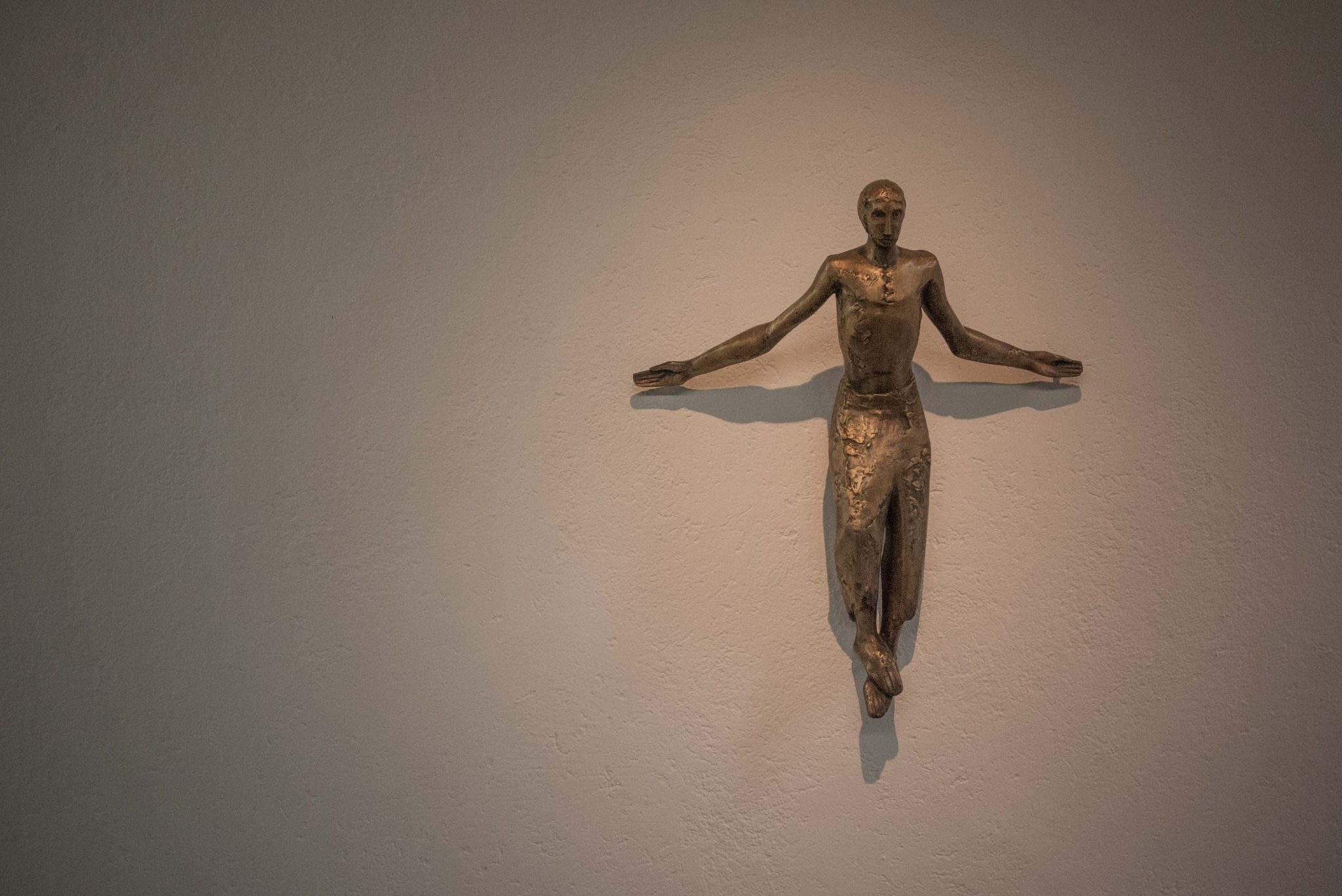Der Synodale Weg startet nicht im Nichts. Themen und Debatte, Formen und auch Konflikte haben ihre Vorgeschichte. Ein Teil der Vorgeschichte ist, dass es ja so etwas Ähnliches schon mal gegeben hatte. Nein, ich meine nicht den Gesprächsprozess vor einigen Jahren, ich meinte die Würzburger Synode. Eine richtige Synode, über mehrere Jahre hinweg, zur Umsetzung der Konzilsbeschlüsse.
Allen Unkenrufen zum Trotz hatte diese gemeinsame Synode viel in Bewegung gesetzt, von Gremien über Religionsunterricht hin zu Laienbeteiligung. Und so würdigt Bischof Bätzing die Arbeit von damals auch mit Blick auf heute: „Ich würde mir wünschen, dass wir bei den nächsten Etappen des Synodalen Weges noch stärker eine Relecture der Texte der Würzburger Synode vornehmen“. Also dann wollen wir mal.
Eine richtige Synode
Ich möchte mich hier nicht verheben und gleich alle Texte lesen, sondern erst mal nur den ersten, „Unsere Hoffnung“ überschrieben. Er ist sowas wie der Schlüssel und das Grunddokument der gemeinsamen Synode. In der Einleitung (von Prof. Theodor Schneider) gibt es eine wichtigen Hinweis für den Text und für unsere Lektüre heute: der Text ist subjektiv. Soll heißen, er versteht sich nicht als offizieller Lehrtext in dem Sinn, dass er die gesamte Bandbreite des Glaubens abbildet.
Er ist zeitbezogen, ich würde hinzufügen auch kulturbezogen. Er fragt nach der Situation in Deutschland und versucht sich an einer Antwort. Das geht natürlich nur in Beschränkung, aber genau diese Beschränkung ist auch eine Stärke. So ein Text muss nicht „als die einzig mögliche Weise eines heutigen Bekenntnisses“ verstanden werden. Er kann sich auf Umstände beziehen, die vielleicht in andere Zeiten und Kulturen anders sind.
Konkret bleiben
Im Text selber klingt das dann so: „Nicht Geschmack und nicht Willkür lassen uns auswählen, sondern der Auftrag, unsere Hoffnung in dieser Zeit und für diese Zeit zu verantworten. Wir wollen von dem sprechen, was uns hier und jetzt notwendig erscheint“.
Das merkt man bei der Lektüre des Textes deutlich. Vieles von dem, was im Text angesprochen ist, ist nicht mehr unser Problem oder nicht mehr unsere Frage. Ich lese das als Ermutigung: nicht alles für alle zu erklären, sondern konkret bleiben. Dann mag das in einigen Jahren vielleicht etwas angestaubt klingen, es mag auch für andere Kulturen und Kirchen nicht so gelten wie für uns, aber das ist eben Inkulturation. Und zur Einheit in Vielfalt gehört das dazu.
Treue und Wandel
Ein Zweites: es mag wie ein Slogan klingen, der zweite Satz des Textes hat sich bei mir aber festgehakt: „Nichts fordert so viel Treue wie lebendiger Wandel“. Da steckt aber sehr viel drin, Spannung genauso wie Balance. Vor allem auch die Einsicht, dass sich das nicht gegeneinander ausspielen lässt. Auch das ist etwas, dem sich der Synodale Weg heute stellt.
Drittens finde ich den dritten Teil bemerkenswert, hier geht es um einige Wege der Nachfolge Jesu. Sich zu Jesus bekennen weist in Richtung seiner Nachfolge, und diese „Nachfolge genügt“. Ein wichtiger Teil dabei ist die Selbstkritik, das zieht sich durch den Text hindurch. Ein Beispiel gefällig?
Wir sind vielleicht „im kirchlichen Leben unseres Landes selbst schon zu fest und unbeweglich in die Systeme und Interessen unseres gesellschaftlichen Lebens eingefügt. Vielleicht haben wir uns inzwischen selbst schon zu sehr anpassen lassen, indem wir weitgehend jenen Platz und jene Funktion eingenommen haben, die uns nicht einfach der Wille Gottes, sondern der geheimnislose Selbsterhaltungswille unserer totalen Bedürfnisgesellschaft und das Interesse an ihrem reibungslosen Ablauf zudiktiert haben. Vielleicht erwecken wir schon zu sehr den Anschein einer gesellschaftlichen Einrichtung zur Beschwichtigung von schmerzlichen Enttäuschungen, zur willkommenen Neutralisierung von unbegriffenen Ängsten und zur Stillegung gefährlicher Erinnerungen und unangepaßter Erwartungen. Der Gefahr einer solchen schleichenden Anpassung an die herrschenden gesellschaftlichen Erwartungen, der Gefahr, als Kreuzesreligion zur Wohlstandsreligion zu werden, müssen wir ins Auge sehen. Denn wenn wir ihr wirklich verfallen, dienen wir schließlich keinem, nicht Gott und nicht den Menschen.“
Selbstkritik
Die Einleitung zu den Synoden-Texten berichtet davon, dass es in den Debatten gerade hier immer wieder Gegenstimmen gegeben habe, viele wollten genau diese Selbstkritik nicht. Schon gar nicht in aller Öffentlichkeit. Die Einleitung erzählt aber auch davon, dass die Mehrheit sich aber immer und immer wieder für die „offensive Gewissenserforschung“ ausgesprochen hat. Das gilt für uns heute genauso, Papst Franziskus kann in seinen Schreiben davon geradezu nicht genug bekommen. Und mindestens der Blick auf die MHG-Studie muss uns heute zur Selbstkritik zwingen.
Aber. Und das ist ein großes Aber: wenn das damals schon so klar war, warum ist dann nichts passiert? Oder zu wenig, viel zu wenig? Wenn wir heute auf unsere Kirche schauen, dann passt die Selbstkritik immer noch. Abgesehen davon, dass es eher noch mehr gibt, was sehr kritisch gesehen werden muss. Warum ist seitdem so wenig passiert? Waren das alles leere Worte?
Leere Worte? Warum ist so wenig passiert?
Beim Lesen des Textes hat mich dieser Gedanke nicht losgelassen. Das gehört auch zur Würzburger Synode dazu, dass dieselben Menschen, die damals Verantwortung trugen, eine Kirche geleitet haben, unter deren Decke Kriminelles passieren konnte und vertuscht wurde.
Und damit das nicht nur ein Vorwurf bleibt, drehe ich das auch mal um. Es ist eine starke Warnung an uns, dass Texte allein heute nicht reichen. Auch die Texte des Synodalen Wegs nicht. Da muss mehr passieren, sonst werden in 50 Jahren die Blicke zurück auf uns ähnlich unbarmherzig sein wie unsere auf unsere Vorfahren im Glauben.
Viertes: Dem Titel des Dokuments entsprechend wird für die Kirche formuliert: „Diese unsere Kirche ist eine Hoffnungsgemeinschaft“. „‚Die Welt‘ braucht keine Verdoppelung ihrer Hoffnungslosigkeit durch Religion; sie braucht und sucht (wenn überhaupt) das Gegengewicht, die Sprengkraft gelebter Hoffnung“. Das das ist eine Perspektive, die wir uns auch heute zu Eigen machen sollten.
Sprengkraft gelebter Hoffnung
Und dazu braucht es vor allem eines, nämlich die Überwindung es Zwiespalts zwischen „der Lebensorientierung an Jesus und der Lebensorientierung an einer Kirche, deren öffentliches Erscheinungsbild nicht hinreichend geprägt ist vom Geist Jesu“. Das war Arbeitsauftrag damals, den die Kirche nicht erfüllt hat, und es bleibt Arbeitsauftrag heute.
Noch kurz vor seinem Tod schrieb Julius Kardinal Döpfner die Einleitung zu dem Band, der alle Synodentexte gemeinsam veröffentlichte.
„Als die Deutsche Bischofskonferenz im Februar 1969 den Grundsatzbeschluß faßte, (…) eine Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland abzuhalten, empfanden viele diesen Entschluß als ein erhebliches Risiko. Die Spannungen in der Kirche erschienen manchen als ein zu großes Hindernis, um ein solches Unternehmen in aller Öffentlichkeit zu wagen. Ja nicht wenige waren der Meinung, eine Synode könnte die Unsicherheit, Konfrontation und Verhärtung der Positionen innerhalb der Kirche nur fördern. Rückblickend darf man dankbar feststellen: Das Wagnis hat sich gelohnt. Nicht die Pessimisten haben Recht behalten, sondern jene, die auf das offene, wenn nötig auch harte Gespräch vertraut haben.“
Mit meinem eigenen Optimismus bin ich vorsichtiger geworden. Grundsätzlich sehe ich dasselbe auch für den Synodalen Weg, er ist eine große Chance, gerade auch weil er so ist wie er ist. Aber das Risiko gehen auch wir heute ein. Es ist es wert.