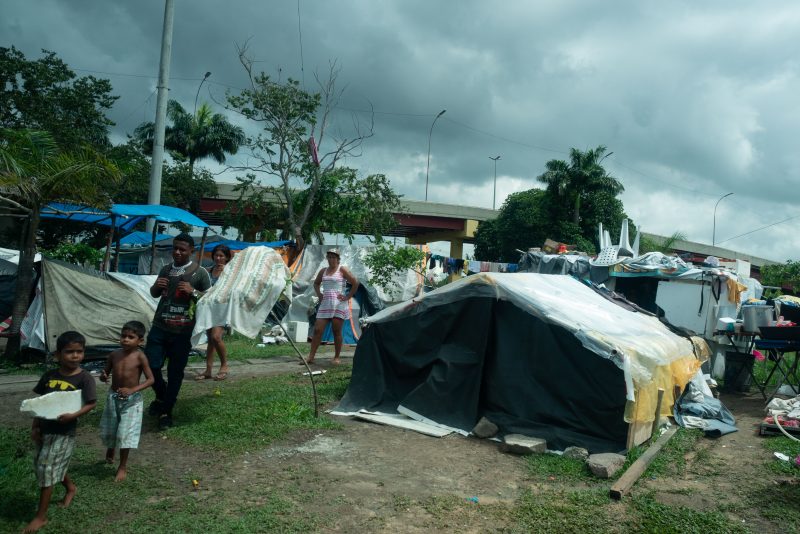Ergebnisorientiertes Tun will gut strukturiert sein. Das war schon bei Beginn des Synodalen Wegs klar, als während der ersten Vollversammlung die Geschäftsordnung debattiert wurde. Strukturiertes Tun: dazu braucht es einen Plan, auch und vielleicht gerade beim Thema Synodalität, weil wir das ja irgendwie noch lernen müssen, als Kirche.
2023 wird es wieder eine Versammlung der Bischofssynode in Rom geben. Und während das lange Jahre immer nach dem gleichen Muster ablief, hat dem Papst Franziskus schon bei der vergangenen Synode einen Vorbereitungs-Prozess vorgeschaltet. Das ist auch dieses Mal wieder der Fall, sogar noch ausgefeilter als letztes Mal. Was ja auch gut ist, schließlich ist das Thema der Synode die „Synodalität“ selbst.
Strukturiertes Tun
Der Vatikan hat nun die einzelnen Etappen des synodalen Prozesses vorgestellt. Zugegeben, mein erster Eindruck war ein kleiner Schock, weil sich viel überkreuzen wird mit dem Synodalen Weg, wie ihn die Kirche in Deutschland geht. Im Oktober, direkt nach der zweiten Vollversammlung des Synodalen Wegs also, soll in den Teilkirchen (Bistümern) die „Phase der Konsultation des Volkes Gottes“ zum Thema der Bischofssynode beginnen. Noch vor Oktober 2021 sollen Verantwortliche dafür in allen Bistümern ernannt werden. Abschluss dieser Phase wird – so der Vatikan – eine „vorsynodale Versammlung“ jeweils auf lokaler Ebene sein.
Da der Synodale Weg bistumsübergreifend stattfindet, kreuzen sich hier einige Kabel. Das will gut koordiniert sein. Es folgt dann eine „kontinentale Phase“, die auch noch mal ein Jahr dauern wird. Mehr dazu kann man auf den Webseiten des Vatikan oder hier lesen.
Ein wirkliches Anhören
„Die Unterteilung des synodalen Prozesses in verschiedene Phasen ermöglicht ein wirkliches Anhören des Gottesvolkes und zugleich eine Einbeziehung aller Bischöfe auf den verschiedenen Eben des kirchlichen Lebens“, heißt es gegen Ende des Vatikandokuments. Eine strukturierte und lang andauernde Phase der Vorbereitung, die hoffentlich das bringen wird, was Papst Franziskus 2015 über Synodalität gesagt hat: „dieser Weg der Synodalität ist das, was Gott sich von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet“.
Die spannendste News bei dem Ganzen: die Versammlung der Bischofssynode wird im Oktober 2023 stattfinden. Nicht wie bisher angekündigt ein Jahr früher. Ein ganzes Jahr wird der Prozess länger dauern, so wichtig ist dem Papst das strukturierte Vorbereiten. „Die Bischofssynode ist der Sammelpunkt (der) Dynamik des gegenseitigen Zuhörens“, so das Vatikandokument. Dieser Dynamik hat nun noch mehr Zeit. Nutzen wir sie!