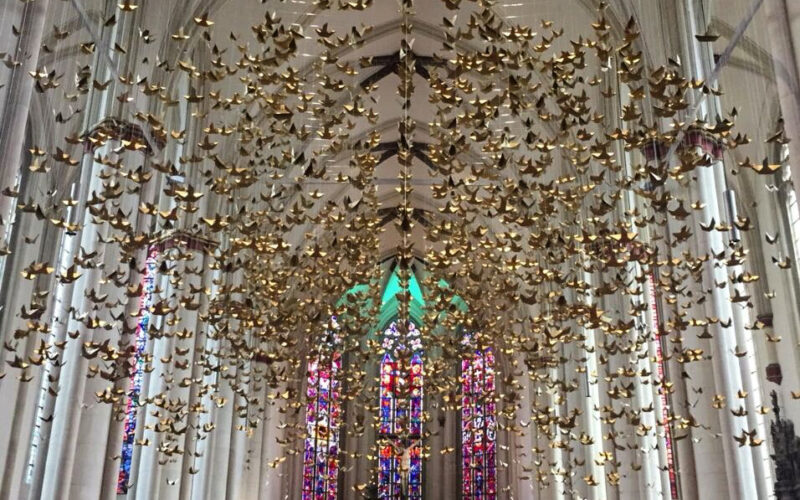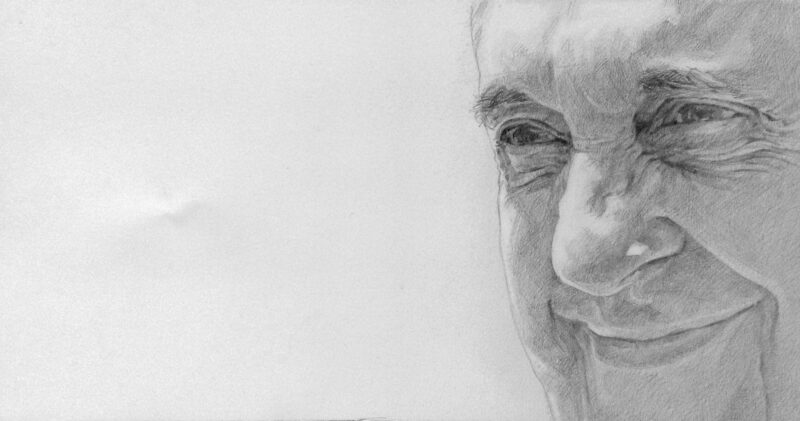Und zum Schluss war es dann doch wieder Rom. Als Kardinal Marx seinen Brief und seine Begründung zum angebotenen Amtsverzicht vorstellte, war der Fokus ganz auf ihm, auf seiner Motivation und Begründung. Mit der Ablehnung des Verzichtes und der Art dieser Ablehnung ist nun Rom wieder ganz im Mittelpunkt. Genauer: Papst Franziskus. Die ganze Sache bekommt die Tonlage Franziskus.
Das Ganze ist sehr schnell gegangen. Drei Wochen nachdem der Kardinal mit seinem Brief bei ihm war hatte Marx schon eine Antwort, das sind nicht unbedingt vatikanische Normalzustände. Das bedeutet, dass das Original-Fraziskus war, da sind nicht alle möglichen Dikasterien mit befasst gewesen. Das ist eine Überzeugungs-Entscheidung des Papstes.
Tonlage Franziskus
Er stärkt den Kardinal in dem, was dieser in seiner Bitte eingeschlossen hatte: die Katastrophe der sexualisierten Gewalt, die Notwendigkeit von Verantwortung, vor allem aber in der Frage nach Reform in der Kirche.
Leider kommt – was an einigen Stellen auch moniert worden ist – die Opferperspektive gar nicht vor, der Brief des Papstes bleibt in der Innenperspektive, der Frage des Gewissens und des Glaubens. Der Papst hat nicht die Absicht, konkret zu werden und genaue Schritte oder Notwendigkeiten zu benennen.
In einer ersten Reaktion auf den Papstbrief hat Kardinal Marx angemerkt: „einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen, kann nicht der Weg für mich und auch nicht für das Erzbistum sein“. Jetzt stellt sich also die Frage, was das bedeutet soll. Rücktritts-Angebot und Papst-Antwort, wenn sie nicht nur Episode bleiben sollen, müssen ja Folgen haben.
Es darf nicht nur Episode bleiben
Der Kardinal spricht von „neuen Wegen“ in der Verkündigung des Evangeliums und von der „Erneuerung der Kirche“. Da hat er sich selber in die Pflicht genommen. So etwas – wenn es synodal gedacht ist – kann nicht nur in Generalvikariaten und in Sitzungen passieren, so etwas muss von „unten“ her wachsen. Mein Vorschlag wäre, im Zugehen auf den synodalen Weg der Weltkirche, der ja in den Bistümern beginnt, mit allen Pfarreien, Gemeinschaften und Verbänden ins Gespräch zu kommen. Direkt. Und zwar zuerst als Hör-Dienst. Der Bischof möge ein Dauer-Reisender in seinem Bistum sein.
Dann ist die Offenheit des Ganzen zu respektieren. Der Papst in seinem Brief macht das ja vor: niemand kommt unverändert aus einer Krise hervor, aber wie genau, das bleibt offen. Er spricht davon, dass wir „zulassen“ müssen; Kirche muss Kontrolle abgeben und die Dauerversuchung, alles irgendwie dann doch in Griff zu behalten. Und so versteht er auch ‚Reform‘, als sich aussetzten, nicht als Machen, nicht als Machtgestus.
Kontrolle abgeben
Noch etwas können wir aus dem Brief entnehmen: die geistliche Grundierung. Der Papst spricht von Sünde. In Ich-Form und Wir-Form. Wir alle sind Teil einer Kirche, welche die Katastrophe des Missbrauchs möglich gemacht hat. Wir müssen auf unsere Sünden-Geschichte schauen, vor Gott. Und um Vergebung bitten, die Opfer, aber auch Gott.
Und dann ist da immer auch die Frage nach der bischöflichen Verantwortung. Die hatte Kardinal Marx in seiner Rücktritts-Bitte ja anders formuliert als viele andere Bischöfe. Bisher wurde fast immer geschaut, ob da jemand was falsch gemacht hat oder nicht. Dass Bischöfe für das Ganze die Verantwortung tragen, galt theologisch als gesetzt. Nur wenn es schief geht, dann will es keiner gewesen sein. So geht Verantwortung nicht.
Verantwortung der Bischöfe
Der Papst schreibt: „Es stimmt, dass die geschichtlichen Vorkommnisse mit der Hermeneutik jener Zeit bewertet werden müssen, in der sie geschehen sind. Das befreit uns aber nicht von der Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen und diese Vorkommnisse anzunehmen als die Geschichte der „Sünde, die uns bedrängt“.“
Ich wünsche mir, dass die Bischöfe und andere Verantwortungsträger in der Kirch auch genau darüber sprechen. Wie sie einzeln und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Dass man keine Fehler gemacht hat ist nur das Minimum, aber Verantwortung ist viel mehr.
Das sind einige Gedanken zu dem, was der Kardinal gesagt hat: wir können nicht wieder zur Tagesordnung übergehen. Vor allem aber gilt, dass wir das nicht vorweg planen können. Hier wie beim Synodalen Weg wie auch bei allen Reform-Vorhaben der Kirche – wenn sie auf den Heiligen Geist setzen – gilt, dass der Ausgang offen ist. Oder in Worten aus dem Brief: wir müssen uns dem stellen, „wohin auch immer das führen wird“.