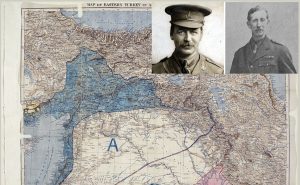Mit der Abschlussmesse heute in Leipzig geht der 100. Katholikentag zu Ende. Ein schöner Erfolg, würde ich mal sagen. Der Geburtstag stand zwar überhaupt nicht im Vordergrund, darfür aber Leipzig als Stadt.
An ein Fazit traue ich mich nicht so richtig heran, dafür habe ich vor allem von den thematischen Dingen zu wenig mitbekommen. Drei vorläufige Schlüsse möchte ich aber dann doch ziehen.
Erstens war es ein Katholikentag für Katholiken. Das hört sich irgendwie selbstverständlich an, aber was ich damit meine ist, dass es sehr viel Selbstvergewisserung war. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Die ganze Breite und Buntheit katholischen Lebens war da und zeigte sich, man war nicht in den Kampfzonen der Pfarrei-Zusammenlegungen oder Finanz-Reformen unterwegs, sondern positiv, im Sonnenschein, immer wieder interessanten Dingen und vor allem Menschen begegnend. Daran hat auch nichts geändert, dass wir in Leipzig sind. Die Stadt hat uns freundlich aufgenommen, interessiert, aber sobald man drei Meter aus der Innenstadt – wo großartigerweise alles konzentriert war – raus war, war man wirklich raus.
Zweitens war die Entscheidung richtig, die AfD nicht aufs Podium einzuladen. Am Samstag hat eine der Vorsitzenden der Partei einem Radiosender ein Interview gegeben, in Leipzig, am Rande des KathoTages. Da konnte man im Kleinen besichtigen, was im Großen passiert wäre. Natürlich haben auch katholische Medien sofort ein Interview mit ihr gemacht und ihr schön viel Öffentlichkeit gegeben. Alle Kameras wären auf diesem einen “Schaukampf” – wie ZdK Präsident Sternberg es nannte – gerichtet gewesen, wenn die Partei offiziell da gewesen wäre und ihren Krawall und Konflikt veranstaltet hätte, alles andere wäre verdrängt worden. Es mag sein, dass das mal dran ist, aber nicht bei einer Vielfalts-Veranstaltung.
Wo immer es um das Flüchtlingsthema ging, ist offen und differenziert gesprochen worden. Das wäre alles den Bach abgegangen, hätte man eine Arena gebildet.
Über das Wie reden

Drittens müssen wir uns Gedanken um die Formate der Veranstaltungen machen. Wir von Radio Vatikan haben zum Beispiel an einem Infostand gestanden, das war gut, da konnte man auch Leuten begegnen, aber bei aller Arbeit meiner Mitarbeiter, für die ich tief dankbar bin, würde ich mir doch etwas mehr Interaktion wünschen. Auch finde ich das Besichtigen von Meinungsinhabern auf der Bühne nicht wirklich spannend, das gibt es in Talkshows schon, das muss man meiner Meinung nach nicht noch verdoppeln. Am Abschlussabend gab es zum Beispiel eine Veranstaltung “Theologie an der Theke”, im informellen Rahmen. Wie wichtig das genommen wurde sieht man daran, dass das Mikro nicht funktionierte und so weiter. Sowas ist gut, kleinere Sachen, mehr Interaktion. Münster als Ort des nächsten Katholikentages wird sich da hoffentlich was einfallen lassen und kreativ sein.
Aber jetzt geht es erst einmal wieder zurück in den Alltag.