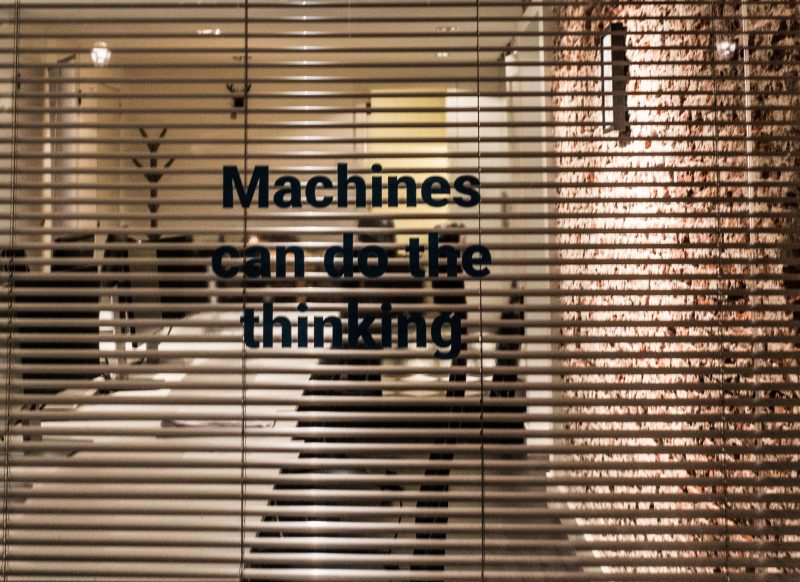„Hoffnungsmüde“: ein Wort von Papst Franziskus, gesprochen in Panamá bei seiner Reise zum Weltjugendtag. Er hat es zu Ordensleuten und Priestern gesagt, aber mir scheint es ein guter Begriff zu sein um die Debatten hier bei uns zu verstehen, die sich um Kirche und Erneuerung drehen. Was tun? Muss sich Kirche wandeln? Sich neu erfinden oder nicht? Ist die alte Zeit zu Ende? Was passiert mit Kirche und Veränderung?
Die Zitate in den Fragen stammen aus den vergangenen Wochen aus den Debatten um den Umgang mit Missbrauch, Autorität und die Frage, wie sich Kirche angesichts all dessen verändern muss.
Kirche und Veränderung
Dass eine Zeitenwende eingetreten sei, das sagt Bischof Franz-Josef Oberbeck (Essen). Es brauche eine „ernsthafte Erneuerung der Kirche“, alles müsse auf den Tisch, Priesterbild und Weiheamt, Hierarchie, Zölibat, Frauenamt und Sexualmoral. Nun gehe es nicht darum, eine bestimmte, vertraute Gestalt der Kirche zu retten, sondern „nach neuen Wegen zu suchen, um mit Gott in Berührung zu kommen”.
Bischof Rudolf Voderholzer (Regensburg) sagt dagegen, Kirche müsse sich nicht „neu erfinden“. Kirche sei Projekt Gottes, und dürfe nicht organisatorisch-menschlich verstanden werden. Neue Wege: Ja, Bekehrung: auf jeden Fall. Aber eben keine Zeitenwende.
Damit hatte Voderholzer – direkt oder unabsichtlich – auf Bischof Georg Bätzing (Limburg) reagiert, der von „neu erfinden“ gesprochen hatte. Es brauche Veränderung. Kirche müsse sich vermehrt daran orientieren, was Menschen bräuchten, eine milieu-gestützte Weitergabe des Glaubens gebe es fast nicht mehr.
„Neu erfinden“?
Interessant ist eine Erfahrung, die Bätzing aus seinem Bistum berichtet und die den Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauch und der Erschütterung der Kirche darüber herstellt. Es habe es ansprechen müssen, von selber sei die Sprache nicht darauf gekommen. Aber sobald es angesprochen worden sei, hätten die Leute „gesprudelt“. Da sitzt also was tief drin, das von sich aus nicht artikuliert werde, Aggression, Enttäuschung, Wut.
Daraus ziehet ich den Schluss, dass wir keine Debatte um Erneuerung führen können, ohne diese Dimension aktiv in die Debatte einzubringen.
Die verschiedenen und zugegeben etwas wahllos heraus gegriffenen Wortmeldungen (ich habe nur die letzten Wochen berücksichtigt und auch nur Bischöfe) können zu einer Art von Lähmung führen. Wenn ich eine Lösung suche, die all die verschiedenen Ansätze und Überzeugungen vereint, dann sind wir schnell blockiert. Und hier kommt dann für mich beim Thema Kirche und Veränderung das Papstwort von der „Hoffnungsmüdigkeit“ ins Spiel.
„Es ist eine lähmende Müdigkeit”
„Es ist eine lähmende Müdigkeit. Sie beginnt damit, dass wir vorausschauend nicht wissen, wie wir angesichts der Intensität und der Ungewissheit des Wandels, den wir als Gesellschaft durchmachen, reagieren sollen“. Der Papst sprach davon, wie schwer es sei, unter den Bedingungen von heute Ordensleben zu leben, aber ich lese das auch als Schlüssel für das leben als Christin und Christ in Gemeinschaft, in Kirche, überhaupt.
„Die Hoffnungsmüdigkeit kommt von der Feststellung, dass die Kirche durch ihre Sünde verwundet ist und dass sie viele Male die zahlreichen Schreie nicht zu hören vermochte, in denen sich der Schrei des Meisters verborgen hatte: ‚Mein Gott, warum hast du mich verlassen‘ (Mt 27,46).“ Damit meint der Papst auch den Missbrauch, den geistlichen, den sexuellen, und den Missbrauch von Macht und Autorität.
Fallen und Enttäuschungen
Die Falle sei nun ein „grauer Pragmatismus“. „Enttäuscht von der Wirklichkeit, die wir nicht verstehen oder in der, wie wir meinen, kein Platz mehr für unser Angebot ist, geben wir einer der übelsten Häresien unserer Zeit „Bürgerrecht“, nämlich zu denken, dass der Herr und unsere Gemeinden in dieser neuen Welt, wie sie abläuft, nichts zu sagen noch zu geben hätten (Evangelii Gaudium, 83).“
Wie da heraus kommen? Rezepte gibt es keine, vielleicht sind die Realitäten auch zu verschieden, um mit einer Lösung darauf reagieren zu können. Überhaupt, von einer Lösung zu sprechen ist vielleicht sogar falsch, es braucht Antworten.
Ein Hinweis vom Papst bekommen wir, wenn wir in der Zeit etwas zurück gehen und das Wort „Hoffnung“ aufgreifen. Der Papst hat es einmal in einer Videobotschaft so ausgedrückt: „Paulus sagt nicht „der Herr hat zu mir gesprochen und gesagt“, oder „der Herr hat mir gezeigt oder mich gelehrt“. Er sagt „er hat mir Barmherzigkeit erwiesen“.“
Antworten, nicht Lösungen
Eine Antwort auf die Müdigkeit liegt also darin, darauf zu schauen, wie Gott mit uns umgeht. „Es ist keine Idee, kein Wunsch, keine Theorie, schon gar keine Ideologie, sondern Barmherzigkeit ist eine konkrete Art und Weise, Schwäche zu „berühren“, sich mit anderen zu verbinden, einander näher zu kommen.“
Hoffnung entsteht mit Gott. „Um zu verstehen und zu akzeptieren, was Gott für uns tut – ein Gott, der nicht aus Angst denkt, liebt oder handelt, sondern weil er uns vertraut und erwartet, dass wir uns wandeln – muss vielleicht dieses unser hermeneutisches Kriterium sein, unser Modus Operandi: „Geht und handelt genauso“ (Lk 10:37). Unser Umgang mit anderen darf deswegen niemals auf Angst aufbauen, sondern auf die Hoffnung Gottes in unsere Umkehr.“
Noch einmal zurück zur Panama-Ansprache: Die Müdigkeit lasse sich nur durch die immer neue Begegnung mit Christus in Hoffnung verwandeln. Und das bedeutet die Begegnung mit dem, der uns barmherzig ansieht. Das bedeutet akzeptieren, dass wir – einzeln und in Gemeinschaft – verwandelt werden müssen.
Wir müssen verwandelt werden
Und damit verschieben wir das Problem der Veränderung nicht ins Spirituelle. Damit gehen wir den vielleicht harten Entscheidungen nicht aus dem Weg. Bischof Overbeck hatte es so gesagt: Neue Wege suchen, mit Gott in Berührung zu kommen. Und die Voraussetzung dafür ist, zu schauen, wo Gott schon in Berührung mit uns war und ist.
Kirche und Veränderung – das wird in der Zukunft nicht einfacher. Lösungen und Rezepte gibt es nicht. Aber wenn unser Christsein von dem geprägt ist, wie Gott sich zu uns verhalten hat, in Barmherzigkeit, dann ist er erste Schritt gemacht und dann kann man auch die verschiedenen Wege vorwärts ideologiefrei besprechen. Dann lähmt das nicht in Müdigkeit, sondern dann bewegt sich da was.