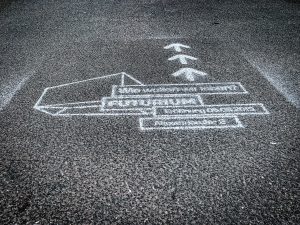Für Jahre lag er im Zentrum meines Lebens: der Petersdom. Ich konnte nicht aus dem Haus gehen, ohne die beeindruckende Präsenz direkt ins Blickfeld zu bekommen. Präsenter kann Kirche gar nicht sein. Präsenter kann auch Gott gar nicht sein, denn schließlich ist Gott dort drin, Gott ist in der Kirche repräsentiert. Im Petersdom ist sogar so viel Gott, das ist kaum zu ertragen. In Heiligen, in Kreuzen, in Bildern, im Raum und den Kuppeln, ich kann Gott dort gar nicht suchen, da ist so viel Anwesenheit, das ist überwältigend. Für Fragen und Suche ist da kein Platz. Diese Kirche ist ein Statement.
Aber genau das ist uns heute ein Problem. Gott ist für viele, und auch vielleicht für uns, fremd. Abwesend. Wir wehren uns gegen die ästhetischen Überwältigungen, die uns im Petersdom und all den anderen Kirchen begegnen. Und das gilt nicht nur für die Ästhetik, sondern auch die Semantik: auch das kirchliche Sprechen über Gott stellt dar und stellt fest, dagegen wehren sich viel um uns herum und vielleicht auch wir selber. Darüber zu sprechen, dazu gab es in den vergangenen Tagen einen – digitalen – Kongress, „Was und wie wenn ohne Gott?” – zum Geistlichen Leben im Verschwinden der Gottessicherheit.
Was und wie wenn ohne Gott?
Die Zustandsbeschreibung laut Kongress: „Für viele hat Gott keine Relevanz mehr, wenn sie nach Antworten nach dem Woher und Wohin suchen. Die naturwissenschaftlichen und technischen Erkenntnisschübe machen uns selbst immer mehr zu Schöpfern der Welt. Religion gilt vielen besorgten Zeitgenossen als Quelle von Macht und Gewalt. Die Missbrauchsskandale haben die Kirche als Rahmen der Gottesbeziehung diskreditiert.”
Wichtig ist das für alles religiöse Tun, auch für den Synodalen Weg, der ja nicht einfach eine Renovierung des Bestehen den sein kann, eine Runderneuerung der Struktur. Wir müssen uns in der neuen Kirche zurecht finden, die eben nicht mehr mit der Omnipräsenz Gottes und der Selbstverständlichkeit Gottes überwältigt.
Ohne die Präsenz Gottes
Gott und Welt sind sich fremd geworden, das war der Tenor des ersten Tages. Säkularer Staat und säkulare Gesellschaft, die naturwissenschaftliche und technizistische Bestreitung des Gottesglaubens, die philosophische Bestreitung des Gottesglaubens: das waren die drei Aufschläge in die Tagung.
Daran schloss sich gleich die eifrig debattierte Frage an, ob diese Bestreitungen nicht auch eine Form Gottes sei, sich uns zu entziehen. Und ob dieser Gottes-Entzug nicht auch eine mögliche Offenbarungsform Gottes sein könnte. Soll heißen: der Entzug Gottes funktioniert als Korrektiv gegen einen „allzu begriffenen Gott“, er zwingt uns zu neuen Weisen, von Gott zu sprechen.
Die Fremdheit Gottes soll fremd bleiben
Oder wie es Tomas Halik formuliert hat: der Entzug Gottes ist vielleicht ein erstes Wort, das an uns ergeht. Ein neuer Weg der Menschenzugewandtheit Gottes.
Mir ging das etwas zu schnell. Wenn dem wirklich so ist, wenn Gott fremd wird, dann müsse wir als erstes diese Andersheit, diese Fremdheit respektieren. Wenn ich von Korrektiv und Chance spreche, wird aus dem „Fremden“ gleich etwas „Eigenes“, mein Korrektiv, meine Chance. Mir geht es da eher wie den Emmaus-Jüngern: im Augenblick des Begreifen, des Schauens ist Gott schon wieder weg. Das Sprechen von Chance und Korrektiv ist mir zu vereinnahmend. Die Fremdheit Gottes soll fremd bleiben.
Spirituelle Entwürfe der Gegenwart
So sind mir die Gottes-Statements des Petersdoms zwar kunstgeschichtlich erschließbar, sagen mir aber für meinen Glauben nichts (mehr). Und das ist erst mal keine Chance, sondern bleibt Fremdheit.
Spirituelle Entwürfe der Gegenwart waren dann Thema des Gesprächs, und zwar von Madeleine Debrêl, Mutter Teresa und Chiara Lubich. Das war sehr dicht und ist sicherlich zu viel für wenige Zeilen hier im Blog. Es war aber wichtig auch in Bezug auf den dann folgenden Punkt: Missbrauch.
Zwischen Mystik und Missbrauch
Diese Spannung zeichnet unseren Gottesglauben heute aus: irgendwo eingespannt zwischen Mystik und Missbrauch. Denn wir können heute nicht über Gottes Anwesenheit oder Abwesenheit sprechen, ohne dass das vorkommt, was im Namen Gottes an Gewalt angetan wurde.
Das macht etwas mit der Gemeinschaft derer, die glauben, bekennen und verkünden und ist nicht einfach abschliebbar. Wir merken das ja auch an der Unglaubwürdigkeit der christlichen Botschaft, der wir in der Gesellschaft begegnen. Das liegt eben auch an der Unglaubwürdigkeit der Botinnen und Boten. Unserer Unglaubwürdigkeit. Kirche – die Gemeinschaft der Glaubenden – trägt bei zur Abwesenheit Gottes.
Mehr Fragen als Antworten
Und auch hier meldete sich wieder meine Vorsicht: nicht zu schnell nach Auflösungen dieser Spannung suchen. Ja, es braucht konkrete Lösungen, aber das nimmt noch nicht das Problem weg, das uns der Missbrauch von Macht auch in der Gottesfrage stellt. Allein von der All”macht” Gottes zu sprechen, braucht Reflexion, das verweigert sich der schnellen Lösungen.
Und so komme ich mit mehr Fragen als Antworten aus der Tagung. Was eine gute Nachricht ist, finde ich. Fragen zu haben und nicht Gottes-Statements, das scheint mir der bessere Weg in eine glaubende Zukunft zu sein.