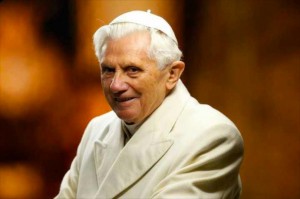Jetzt also auch Lateinamerika. Ganz verschiedene Teilkirchen auf der Welt haben ihre jeweils ganz eigene synodale Formen entwickelt, nicht zuletzt auch die Kirche in Deutschland. Mit Lateinamerika tritt nun ein ganzer Kontinent auf den Plan.
Eigentlich sollte es eine erneute Bischofsversammlung des CELAM werden, der Vereinigung der Bischöfe des Kontinents. So eine hatte es zuletzt 2007 in Aparecida gegeben, unter maßgeblicher Beteiligung des heutigen Papstes. Franziskus war es aber auch, der dem Unternehmen eine neue Richtung gab: nicht nur die Bischöfe sollten sich versammeln, sondern es sollte eine Versammlung gemeinsam mit dem Volk Gottes sein.
Ganz eigene synodale Formen
„Nein, es ist etwas anders, eine Versammlung des Gottesvolks: von Laien, Ordensmännern und -Frauen, Priestern und Bischöfen, das ganze Volk Gottes im Aufbruch: es betet, redet, denkt, diskutiert, auf der Suche nach dem Willen Gottes. (…) Außerhalb des Gottesvolks gibt es Eliten, erleuchtet von dieser oder jener Ideologie, und das ist nicht die Kirche. Die Kirche ist im Brotbrechen, gibt sich allen hin, ohne auszuschließen. Eine Versammlung der Kirchen ist Zeichen einer Kirche die keinen ausschließt.“
So drückte es der Papst in einem Video an CELAM aus. Keine Eliten, alle sollen beteiligt werden. Das ist eine weitere Form, Synodalität für die Kirche heute zu entwickeln.
In Deutschland ist es der Synodale Weg, der sein eigenes Experiment versucht. Die Kirche in Australien benutzt sogar das Wort „Konzil“, um ihren Prozess zu beschreiben. Polen und Italien sind ebenfalls dabei, sich auf einen Prozess vorzubereiten, das italienische Projekt trägt auch bereits die Unterschrift des Papstes.
Das Weltkirchen-Argument
Das alles kann auch uns helfen: Wenn ich in unseren Debatten das Wort „Weltkirche“ höre, dann hat das leider mittlerweile einen unschönen Beiklang. Als ob es das Argument wäre, Debatten bei uns zu blockieren. Dabei zeigt der Blick über unseren eigenen Horizont doch nur, wie viele andere ihre Wege suchen. Vielleicht sollten wir anstatt das Weltlkirchen-Argument mit Verdacht zu belegen uns um Kontakt und Austausch bemühen. Weltkirche, das ist nicht nur Rom, das sind eben auch Lateinamerika und Australien und Italien und Polen und bald auch Irland.
Der Papst hat uns mit auf den Weg gegeben, nicht nur auf die eigenen Kräfte zu vertrauen. Der weltkirchliche Horizont auf die anderen synodalen Bewegungen wäre eine eine große Hilfe dazu.