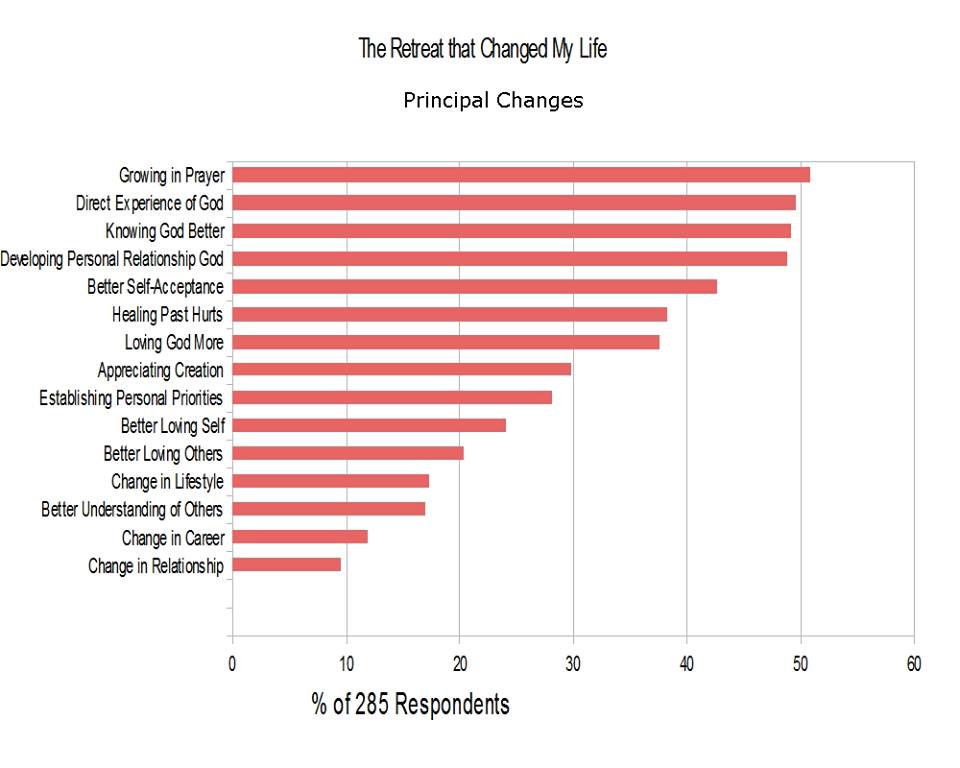Das Böse hat auf einmal einen Ort: Trisulti. Wer in den vergangenen Monaten die Berichterstattung um Kirche und Populismus beobachtet hat, dem wird dieser Name schon einmal begegnet sein. Verbunden mit einem anderen Namen, dem Namen einer Person: Steve Bannon.
Allen ehrbaren Menschen sollte an dieser Stelle der vorgesehene Schauer über den Rücken laufen.
2017 war ich mal dort, im März war das, zu einer Wanderung im benachbarten Höllental. Dabei ist auch das Foto entstanden. Eigentlich eine wunderbare Gegend, weit weit ab von allem, da kommt nicht mehr viel. Herrlich zum Wandern, man kommt nur schwer hin.
Kirche und Populismus
Bannon – das ist seit dem Wahlsieg Trumps die Erklärung für vieles. Dass dieser Mann Präsident der USA werden konnte, das muss einfach an den Fähigkeiten dieses Mannes gelegen haben. Eine Mischung von Machiavelli und Darth Vader, irgendwie sowas. Rau und so überhaupt nicht angepasst, rein ästhetisch schon nicht, da muss was Gefährliches dran sein.
Und der kommt jetzt nach Europa, um hier die Politik aufzumischen. Zuerst war da die Nachricht, seine wilde Nachrichtenplattform BreitbartNews würde auch in Europa den Medienbetrieb aufmischen wollen. Erst war da Aufregung, aber daraus wurde dann wohl nix. Oder haben Sie nach den Aufregern jemals wieder was davon gehört? Eben.
Nach den Aufregern
Jetzt also der Meister persönlich. Dass auch in den USA BreitbartNews keinen Schnitt mehr macht, lassen wir mal beiseite. Verschiedene Medien berichten, die Besucherzahlen auf der Webseite hätten sich halbiert. Was aber dem Ruf Bannons nichts anhaben kann.
Und nun kommt Trisulti ins Spiel. Eine Stiftung, Dignitatis Humanae Institute, hat dieses Kloster gepachtet und will dort eine Gladiatorenschule für Kulturkämpfer einrichten. Gefahr im Verzug für die Demokratie in Europa? Kirche und Populismus, ist da eine Verschwörung im Gange?
Verschwörung geht immer
Es scheint so, verfolgt man die Berichterstattung. Hier würde sich die dunkle Seite der Macht in der Kirche verbünden, Namen fallen, Projekte werden gemutmaßt, der sprichwörtliche Teufel an die sprichwörtliche Wand gemalt. Und die Gladiatorenschule lässt dann junge, dynamische, gut ausgebildete Streiter für die dunkle Seite ahnen und befürchten.
Ein beliebiger Artikel aus dem Netz, nehmen wir mal NBC: „Strolling through St. Peter’s Square, the heart of the Roman Catholic Church, Steve Bannon surveyed the enemy camp.” Und so weiter.
Dabei fällt kaum auf, wie schwach diese Geschichte ist.
Eine schwache Geschichte
Ein Beispiel: Um überhaupt eine Verbindung zum Vatikan herstellen zu können, wird die Verbindung zu Kardinal Raymond Leo Burke gezogen. Die hätten sich bei der Heiligsprechung Johannes Paul II. getroffen, heißt es. Leute, das war 2014! Da war noch längst keine Rede von Trump und Breitbart und dergleichen. Der sei ein Freund von Steve Bannon. Wirklich?
Außerdem, warum fällt niemandem auf, wie krass dieses Duo ist? Burke der klare Konservative, der bewahren will was war. Bannon der selbsterklärte Zerstörer, das genaue Gegenteil eines Konservativen. Wie das zusammen gehen soll, hat noch niemand erklärt. Kirche und Populismus, etwas komplexer ist das dann doch.
Den meisten reicht es leider, Namen zu nennen. Und Lagerdenken wachzurufen. Und dann kommt er schon, der Schauer auf dem Rücken.
Der Zerstörer und der Konservative
Zweitens: Trisulti, die Kartause. Die ist für 19 Jahre gepachtet, für eine jährliche Pacht von 100.000 Euro, wird berichtet. Hier werde dann der Kampf gegen Säkularismus geführt, gegen Islamisierung, gegen antikirchliche Kräfte, gegen überhaupt alles. Benjamin Harnwell, Vertreter der Stiftung und Brite, von Bannon öffentlich gelobt, erklärt viel und gerne, was er so alles vorhabe. Und gerne bezieht er sich auf Bannon, lobt Bannon, weiß um die Macht, die Bannon über die Vorstellungskraft von Journalisten hat.
Nun gibt es da aber ein Problem. Und zwar hat die Stiftung für den Unterhalt einer Bildungseinrichtung im Kloster gar keine Betriebserlaubnis für das Projekt. Die Idee widerspräche dem Abkommen zur Pacht, erklärte der zuständige Mann des italienischen Kultusministeriums – einer populistischen Regierung – bei einer Anhörung im Parlament. Die Ausschreibung schließt eine Bedingung ein, die nicht erfüllt sei, da geht es um das Betreiben eines Museums, das (nicht erfüllte) Voraussetzung sei. Das ist also noch bar nicht entschieden, ob das Institut das überhaupt darf, was aber die Berichterstattung über Darth Bannon nicht beeinträchtigt.
In einigen Blogs finden in Trisulti schon Veranstaltungen statt, Bannon sei per Video dabei. Außerdem sei das Kloster schon umgebaut und so weiter. Alles Schall und Rauch, alles falsch.
Eine Nebenbemerkung, bevor ich zu meinem dritten Punkt komme: Eine Kritik an Papst Franziskus lautet, er sei zu politisch. Und jetzt wollen genau diese Kritiker ein kulturkämpferisches Institut mit kirchlichem Label bauen. Ironie, wer sie denn versteht.
Das Problem der Betriebserlaubnis
Drittens: und überhaupt. Anfang April gab es in Mailand auf Einladung von Matteo Salvini von der Lega ein Treffen europäischer Populisten. Die AfD war dabei, der ehemalige Front National, und so weiter. Alles, was sich in Europa populistisch bewegt. Wer war nicht dabei: Bannon. Er war offenbar nicht eingeladen.
Anfang Dezember war Bannon noch dabei, jetzt nicht mehr. In der TAZ gab es einen wunderbaren Artikel, in dem dem angeblichen Einfluss Bannons nachrecherchiert wurde. Überschrift des Artikels: „Total Loser”. Mehr braucht es eigentlich gar nicht, aber der Artikel lohnt sich zu lesen. Kurse? Gladiatoren? Fehlanzeige.
Keine Gladiatoren in Sicht
Vor einigen Tagen im Guardian: Bannon habe Salvini geraten, Papst Franziskus anzugreifen, wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen. Die Lega konnte sich gar nicht schnell genug distanzieren. Wie gesagt, keiner will was mit ihm zu tun haben, dem Faszinosum Darth Bannon.
Eine schwache Geschichte, ein überschätzter Gegner, dieser Bannon. Keiner will mit ihm was zu tun haben. Er taucht in Rom auf, lässt sich interviewen in Hoffnung auf den Schauer auf dem Rücken, passieren tut aber nicht viel. Außer Berichten in den Medien, die mit dem Grusel spielen.
Kirche und Populismus ist das nicht. Dieser Kaiser hat keine Kleider an.
In einem der vielen Interviews sagt Bannons Statthalter Harnwell zum Abschluss, dass er bis vor kurzem völlig unbekannt gewesen sei. Er verstehe die ganze Aufregung nicht.
Ich auch nicht.