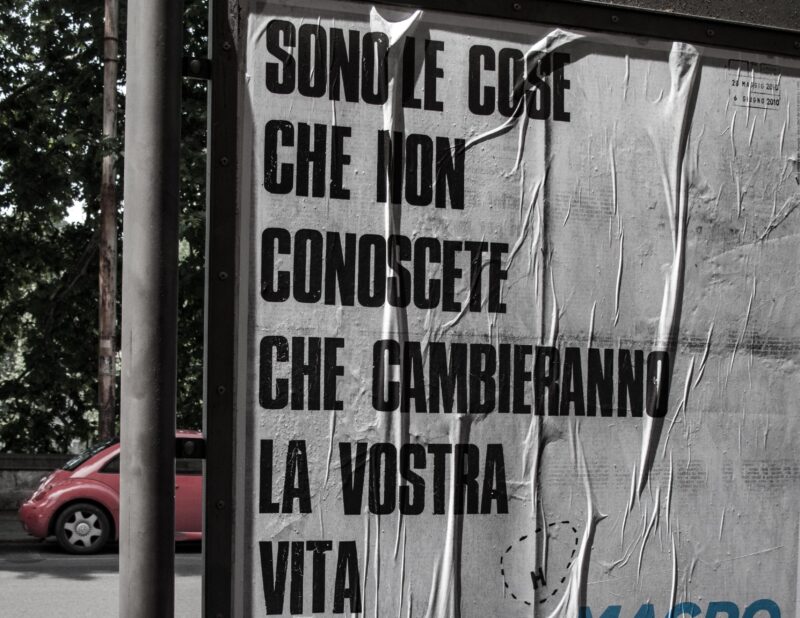Mir geht es gut. Ich kann in meiner Gemeinschaft von Jesuiten Messe feiern, nie allein, ohne Ticket und Beschränkung in unserem großen Haushalt. Ok, ohne Musik, das ist schade, aber sonst haben wir viel weniger Einschränkungen als die meisten anderen. Außerhalb des Schutzraumes unserer Hauskapelle ist Liturgie in Unordnung geraten. Immer schon ein Ort der Auseinandersetzungen in der Kirche wird dort nun sichtbar, wie schwach Kirche und kirchliche Bindung mittlerweile geworden ist.
Liturgie in Unordnung
Damit gehört auch die Liturgie, der Vollzug der betenden Gemeinschaft, fest in den Reformbereich. Wir müssen uns neu darum kümmern, sonst sind unsere Kirchen bald leer. Spätestens in einer Generation.
Zwei Nachrichten aus den vergangenen Wochen lassen mich aufmerken.
Zum einen gilt im Petersdom seit kurzem ein Verbot von Einzelmessen an den vielen Altären. Wer dort morgens die Messe feiern möchte, der muss das von nun an in Gruppen machen. Viel Protest gab es, Priester hätten ein Recht auf Einzelmessen und dergleichen. Abt Jeremias Schröder hat eine gute Erwiderung darauf: Mitarbeiter im Vatikan und dort vor allem die Priester brauchen mehr Erdung, und auch mehr liturgische Erdung, und keine Vereinzelung.
Mess-Verbote im Petersdom
Die zweite Nachricht ist etwas verwirrender, und zwar gibt es nach dem Ausscheiden von Kardinal Sarah erst einmal keinen neuen Präfekt für die Liturgie-Kongregation im Vatikan, also die Aufsichtsbehörde über Gottesdienste. Sondern erst einmal eine „beratende“ Visitation. Sehr ungewöhnlich.
Aber scheinbar ist Papst Franziskus nicht einverstanden mit der Organisation dort, so dass er den sehr ungewöhnlichen Schritt einer Evaluation von Außen macht. Verständlich, denn die eigentlichen Mitglieder der Kongregation – Bischöfe und Kardinäle aus der Weltkirche – haben sich während der Amtszeit von Sarah nur ein mal getroffen. Entscheidungen traf Rom, ohne Beratung. So soll es wohl – das ist das Signal dieser Visitation – nicht weiter gehen.
Ungewöhnliche Visitation
Beide Aktionen sind so etwas wie eine Liturgiereform im Kleinen. So denn die Schlüsse daraus gezogen werden, was im Vatikan wahrlich nicht immer der Fall ist.
Corona hat unsere Weise zu feiern erschüttert. Weil es nicht mehr geht. Weil sichtbar wird, dass diese Form des Feierns nicht zukunftsfähig ist.
Wenn wir uns an die Zukunftsfähigkeit unserer Kirche und die Weitergabe unseres Glaubens an kommende Generationen machen, wenn wir über dringende Reformen nachdenken, dann gehört die Liturgie auch dazu. Dringend.
Dringende Reform
Dazu braucht es vor allem ein Ernstnehmen von Liturgie. Wer ernst genommen werden will, der muss selber ernst nehmen, so wie alte Regel.
Oft genug scheint mir, dass Liturgie einen anderen Zweck hat als sich selbst, als die Feier des Glaubens. Da soll eine Vorstellung von Glauben hoch gehalten werden, welche die meisten Gläubigen nicht mehr mitgehen wollen und können. Und hier geht es nicht um Zeitgeist, hier geht es darum, verantwortet zu schauen, was dem Auftrag Jesu heute gerecht wird.
Der Auftrag Jesu
Die Auseinandersetzung darüber, was Liturgie sein soll, ist so alt wie die jüngste große Liturgiereform, die des Zweiten Vatikanums selber. 1966 hat beim Katholikentag in Bamberg der damalige Prof. Joseph Ratzinger sich die Kritiker an der Reform vorgenommen, diese Kritik bedeute,
„Liturgie ins Museum der Vergangenheit einreihen, in die ästhetische Neutralisierung abdrängen und von vornherein voraussetzen, dass sie in ihrer ursprünglich gemeinten Bedeutung heute gar nicht mehr gemeint sein kann. In diesem Sinn beruht das Skandalöse der Liturgiereform darin, daß sie durchaus naiv genug ist, Liturgie noch immer so zu meinen, wie sie eigentlich gemeint war: nämlich sie ernst zu nehmen als das, was sie ist.“
Liturgie ernst nehmen als das, was sie ist
Und was ist Liturgie? Eben nicht das, als was sie oft genug gefeiert wird, als Darstellung der Kirche. Der Hierarchie. Der Struktur.
Es ist wie bei dem liturgischen Element der Fußwaschung am Gründonnerstag, wo bis zu Papst Franziskus’ Entscheidung in den liturgischen Büchern vorgesehen war, dass nur Männern die Füße gewaschen werden sollen. Bis eben der Papst einer Frau und einer Muslima noch dazu den Dienst erwies.
Wie die Fußwaschung ist auch die gesamte Liturgie „Mandatum“, also Gebot. Weil sich hier ausdrückt, was Jesus als sein Gebot aufgetragen hatte: liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dient einander. Der erste soll euer Diener sein. Und so weiter. Und dieser Dienst ist nicht symbolisch, er ist real und hat mit sich Bücken und Waschen zu tun.
Liturgie, das ist muss bleiben die Feier des Glaubens, nicht die Darstellung von Kirche.