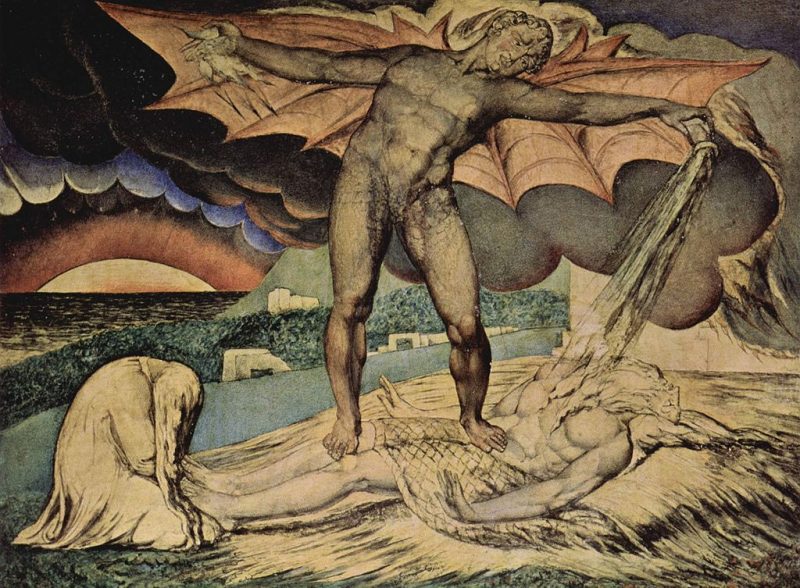Die Urkirche ist das Vorbild. Seit ich denken kann, ist das Bild der in die Vergangenheit gelegten Utopie – wie es am Anfang war – Argument für Wandel und Veränderung. Die Urkirche, da wollen wir wieder hin. Ohne das, was danach gekommen ist. Urkirche als perfekte Kirche.
Jeder Exeget weiß, dass das so nicht sein kann, liest man die Geschichten, die wir darüber haben, also die Apostelgeschichte. Papst Franziskus hat an diesem Mittwoch eine Katechesereihe genau zu diesem Buch begonnen. Und jeder Historiker der ausgehenden Antike und des frühen Mittelalters weiß, dass der Traum dieser unverfälschten Kirche eher dem 20. denn dem 1. oder 2. Jahrhundert entspricht.
Urkirche als perfekte Kirche
Und doch ist die Vorstellung einer echten, unverfälschten Kirche sehr stark. Wobei ich vermute, dass man die kulturellen und historischen Umstände eher nicht wieder haben will, die Urkirche muss also abstrakt bleiben, um als Vorbild oder Utopie dienen zu können.
Aber wie gesagt, es war vielleicht gar nicht so, wie wir immer dachten. Vor einiger Zeit hat zum Beispiel Stephan Heid, Leiter der römischen Görres-Gesellschaft, die These vertreten, dass es die berühmten Hauskirchen – Gläubige versammeln sich in einem Haus und feiern gemeinsam – so nie gegeben hat. Und diese These auf Ausgrabungen gestützt.
Wachsen der Gemeinde
Oder schauen wir uns in Rom um: Santa Maria Antiqua, eine Kirche wahrscheinlich aus dem 5. Jahrhundert und damit eine der ältesten Roms, ist schon sehr spät für den Begriff der Urkirche, aber hier wird ein liturgischer Raum fassbar, der anders ist als wir heute Gottesdienste feiern, der aber klar liturgisch gegliedert ist. Da muss man sich anstrengen, um zu verstehen, wie damals geglaubt und der Glaube gefeiert wurde.
Aber das beste Zeugnis bleibt die Apostelgeschichte. Das einzige erzählerische Buch des Neuen Testaments, in dem Jesus Christus im Mittelpunkt der Erzählung steht, sondern die Gemeinde. Christentum wird an den Nachfolgenden erzählt.
Apostelgeschichte
Die Geschichte beginnt zwar mit Jesus, aber programmatisch: Fristen und Zeiten können die Jünger nicht kennen, aber sie werden den Heiligen Geist und dessen Kraft empfangen. Wissen gibt es also nicht, keinen auszuübenden Plan, keine Blaupause, sondern das Vertrauen auf den in den Menschen handelnden Gott.
Und so wird erzählt. Wer in der Osterzeit die Tageslesungen verfolgt, wird durch dieses Buch geführt. Am Tag der Generalaudienz des Papstes etwa, am Mittwoch, haben wir von Paulus gelesen, der etwas naiv den Athenern Glauben zu erklären versucht und den Zeitlosen Spruch „dazu wollen wir dich ein anderes Mal hören” erntet. Erstaunlich, dass trotzdem eine Kerngemeinde entsteht.
Ein naiver Paulus
Das Buch durchzieht eine Dynamik: erst die Gemeinde in Jerusalem, dann in Samarien und Judäa und dann noch weiter die Kirche unter den Völkern. Hier breitet sich etwas aus, Glaube und Gemeinde, beides immer zusammen. Einzeln ist das nicht zu haben. Weder die Kirche ohne die Verkündung, noch der Glaube an Christus ohne die Gemeinde.
Das Buch endet – ein zweiter wichtiger Punkt – mit dem Wort „Freimut“. Paulus ist in Rom und verkündet den Glauben, „Er verkündete das Reich Gottes und lehrte über Jesus Christus, den Herrn – mi allem Freimut, ungehindert.“ Nicht gebunden an eine Sozialform, an die erste Jüngergemeinde in Jerusalem, mit der er ja seine Konflikte hatte, nicht gebunden an die Synagoge. Das Evangelium ist für alle Völker.
Angekommen in Rom
Wenn wir also Neues wissen wollen über unseren Glauben und dazu die Urkirche befragen, dann ist gerade das Buch der Apostelgeschichte lehrreich. Weniger historisch in dem Sinn, als dass wir uns da Genaues abschauen können.
Aber hier wird geschildert, wie Glaube und Gemeinde wachsen, vom Heiligen Geist geführt. Nicht alles ist immer gleich ein großer Erfolg, im Gegenteil. Aber die Grundzüge werden sichtbar. Und spätestens hier können wir das Neue und immer neu bleibende für uns lesen.