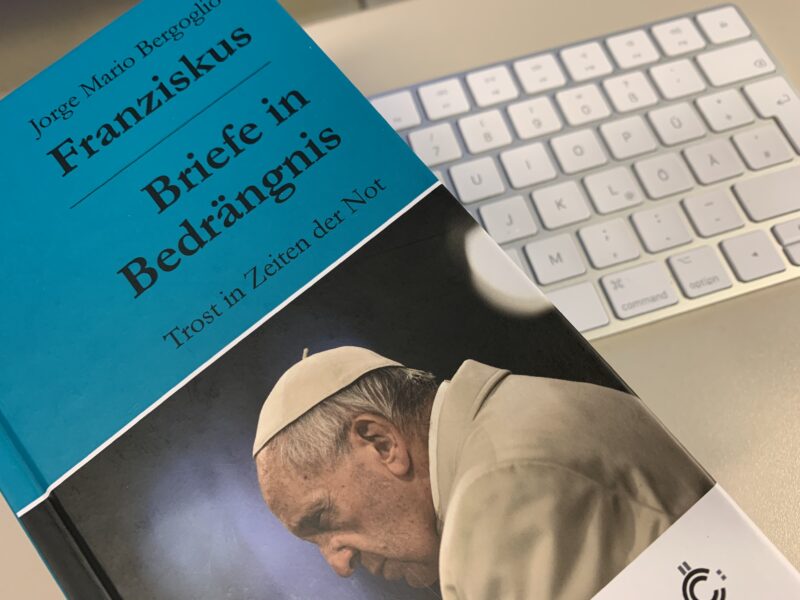„Wo Gott kein Fest mehr wird, hat er aufgehört, Alltag zu sein“: ein Satz von Kurt Marti, der zur Zeit an meinem Rechner klebt. Der passt zu einer Tagung, an der ich – online – in den vergangenen Tagen teilgenommen habe. „Gottesdienst und Macht“ war diese untertitelt, der Untertitel „Klerikalismus in der Liturgie“ gab die Richtung an.
Es ging um Macht. Um Vollmacht, Autorität, um Zugang und Ausübung von Macht in der Liturgie. Und spätestens seit der MHG-Studie wissen wir, dass wir dringend über Macht und deren Missbruch sprechen müssen. Auch in der Liturgie, wie Bischof Ackermann zur Begrüßung sagte.
Klerikalismus in der Liturgie
Den Vorträgen und Debatten bin ich natürlich auch als Priester gefolgt. Auch mir stellt sich ja die Frage, wie ich selber auftrete, handle, Vollmacht als Priester ausübe. Es war also auch eine kleine Gewissens- und Praxis-Prüfung für mich. Außerdem ist Liturgie ja kirchlich kein harmloses Thema, mindestens die Debatte um die außerordentliche Form des Ritus zeigt das immer wieder.
Nun gab es bei der Debatte und der Tagung zwei verschiedene Kritiken an Amt und Macht: zum einen den Klerikalismus. Also nicht im Dienst an Gottesdienst und Gemeinde zu handeln, sondern für sich selbst. Oder auch: die Differenz zum eigenen Profil zu machen. Daneben gab es aber auch grundsätzliche Kritik: die Weise, wie theologisch und liturgisch Amt und Dienst begründet und gestaltet würden, sei nicht sachgerecht.
Nun mag ich die ganzen Debatten hier nicht nachzeichnen, sie ist ja auch noch nicht vorbei und wird mindestens im Synodalen Weg auch weiter geführt.
Glaube ist Fest
Mir geht es hier eher um den Satz vom Eingang. Diesen Charakter von Liturgie, also das Fest, darf das zeichenhafte Handeln nicht verdecken. Fest meint jetzt nicht gute Laune und so, sondern eine Sondersituation, die eben nicht Alltag ist. Im Fest sind die Dinge anders als im Alltag.
Dem steht aber nicht nur Klerikalismus entgegen. Wenn ich im Winter in der Kirche sitze und um mich herum die Menschen in Mänteln in Sitzbänke einsortiert sind, dann frage ich mich schon, ob das noch irgendwas mit Fest zu tun hat.
Wir müssen uns wieder um das Fest kümmern, um die Ausgestaltung und um das, was dem entgegen steht. Das Sprechen über und dann das Gestalten von Liturgie ist eine Quelle von Erneuerung. Wenn wir uns zum Ziel setzen, den Blick auf Jesus nicht zu verbauen. Es gibt Amt und Regeln, es gibt das allgemeine Priestertum und das geweihte Priestertum. Es gibt eine Vielfalt von Liturgien, zu denen vielleicht auch noch neue kommen können. Die Corona-Zeit ermöglicht vielleicht Kreativität aus Not.
All das will belebt sein. Theologisch, aber auch praktisch. Ohne da wird das nichts mit der Umkehr der Kirche und der Ausrichtung auf Verkündigung.