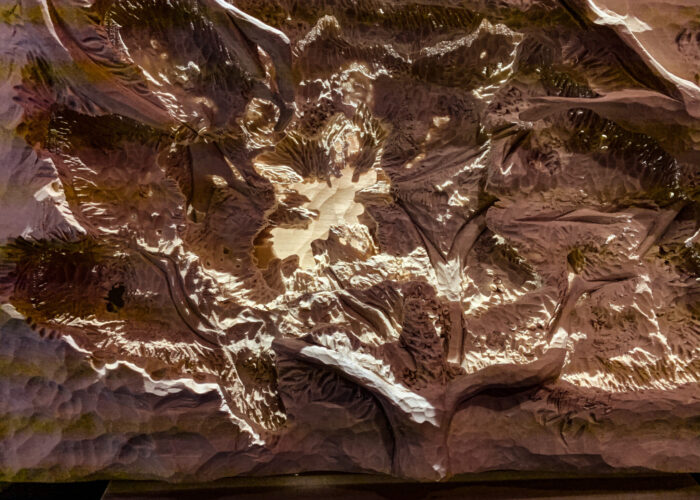„Für den Synodalen Weg gibt es eine Geistliche Begleiterin und einen Geistlichen Begleiter. Sie geben spirituelle Impulse und sorgen für eine geistliche Reflexion der Arbeit der Synodalversammlung.“ So nüchtern sagt es die Satzung für den synodalen Weg. Einer dieser beiden bin ich.
Und so sitze ich seit Donnerstag erst im Bartholomäusdom in Frankfurt und seit Freitag in der Aula des ehemaligen Dominikanerklosters, gemeinsam mit Maria Boxberg. Wir sollen diesen synodalen Weg geistlich begleiten.
Geistliche Reflexion der Arbeit der Synodalversammlung
Papst Franziskus spricht von einem gemeinsamen Weg unter der Führung des Heiligen Geistes. Es geht um das Hinhören, um das Erkennen neuer Horizonte, um die Einwirkung des Heiligen Geistes. Dem auf die Spur zu kommen ist Teil des synodalen Weges.
Das ist die Aufgabe aller Mitglieder. Wir beiden sind hier dabei, um Hilfestellungen zu leisten, wie ein Sportlehrer am Barren. Wir beiden wollen Räume schaffen – zeitliche, innerliche – damit diese Dimension unseres Glaubens hier vorkommen kann. Unsere Hilfestellung will eine Weitung der Debatten.
Eine Weitung der Debatten
Wie genau das passieren wird, werden wir noch heraus finden. Wir überhaupt der gesamte synodale Weg muss sich auch geistliche Begleitung beim Tun erfinden. Es gibt Vorbilder, etwa bei kanonischen Synoden in Bistümern oder bei den Versammlungen der Bischofssynode in Rom, aber was wir hier machen muss sich noch finden.
Es gibt kein festes Muster, nach dem wir agieren. Das wir sozusagen auf die Versammlung drauf legen. Oder anders formuliert, wir reagieren auf das, was in den Debatten und unter den Mitgliedern passiert.
Schwerpunkte unseres Tuns
Aber es gibt natürlich Schwerpunkte. Das Hinhören und das Lernen etwa. Im Anderen, in den Anderen, und auch in mir auf die Stimme Gottes zu hören. Dazu braucht es neben Zeiten des Redens auch Zeiten der Stille, neben der Debatte auch das Gebet.
Wir beide sind nicht hier, weil wir dazu zuständig wären. Wir sind nicht die Delegierten fürs Fromme. Für die geistliche Dimension zuständig sind die Beteiligten, das möchte ich noch mal betonen.
Hören, Unterscheiden, Antworten
Es ist unser Anliegen, dass die Tage der Vollversammlung geistliche Elemente bekommen. Uns geht es dabei ums Hören, Unterscheiden, Antworten. Es geht um Kommunikationsfähigkeit – mit sich selbst, dem Anderen, mit Gott – um Konfliktfähigkeit, um Gemeinschaft in Verschiedenheit, um Anliegen und Überzeugungen. Um gemeinsames Beten. Um reifen Umgang miteinander. Um innere Freiheit. Um Mut und Zutrauen.
Und wie genau das passiert, das zeigt sich jetzt in diesen Tagen.