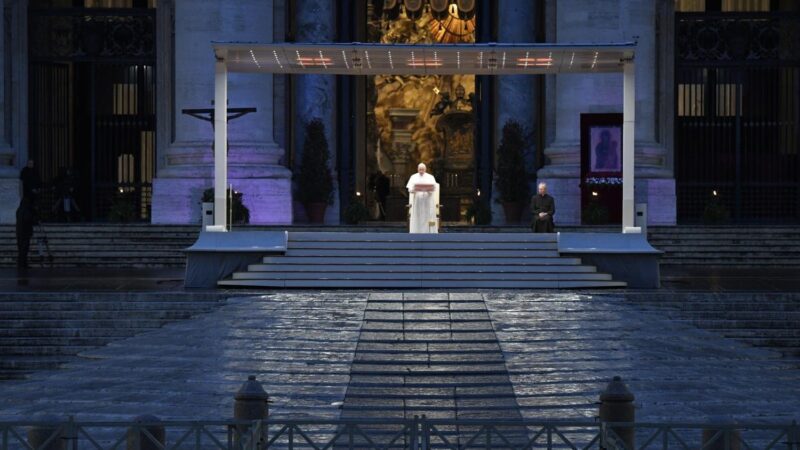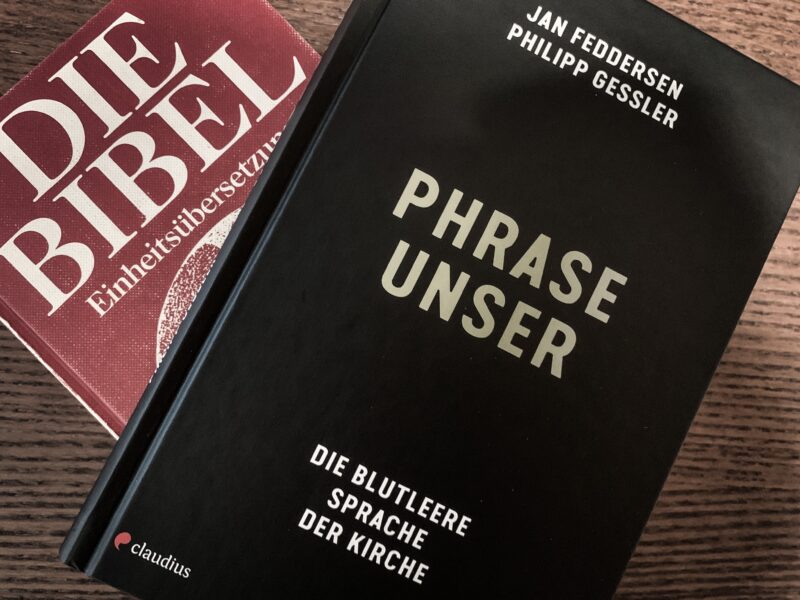In der Philosophie nennt man es einen ‚naturalistischen Fehlschluss‘: Aus der Bewertung als ‚gut‘ wird ein ‚muss‘ abgeleitet, also ein Sollen. Das Problem: aus dem Sein folgt noch kein Sollen. Dafür brauche ich einen Schritt mehr, ein Sollen kann sich nur aus einem anderen Sollen ergeben. Wenn der Schritt nicht gemacht wird, ist es eben ein Fehlschluss.
Weswegen ich das hier anbringe: Nicht aus dem Virus ergeben sich die vielen Maßnahmen, die uns derzeit belasten. Sondern aus dem Mandat, Menschenleben zu schützen und zu retten. Letzteres ist das Sollen. Klingt erst mal banal, hat aber wichtige Auswirkungen.
Aus dem Sein folgt noch kein Sollen
Bei der vielen Berichterstattung zu den Maßnahmen zum Corona-Virus ist mir vor einigen Tagen ein Philosoph untergekommen. Der wies auf eine Merkwürdigkeit des Politischen in diesen Tagen hin.
Zum einen würden die Experten den Rahmen des zu Tuenden definieren. Statistiken, vorsichtige Projektionen was noch passieren könnte, Ansteckungsmöglichkeiten, all das wird von Politik derzeit in Maßnahmen umgesetzt.
So schlimm und einschneidend das ist, es klingt selbstverständlich. Es gibt kluge und zurückhaltende Zweifel, es gibt rechtsstaatliche Debatten, aber keinen Widerstand gegen die Maßnahmen, weil die halt angesagt sind. Die Experten warnen und definieren, was gemacht werden muss. Und die Politik handelt.
Prinzipien bestimmen, nicht Wissenschaft
Was getan werden soll, ergibt sich aber nicht aus naturwissenschaftlichen Tatsachen, so der Philosoph Markus Gabriel. Sondern aus – meine Worte – politischen Prinzipien. Erst die Entscheidung, Menschen zu schützen, gibt der Politik das Mandat so oder eben anders zu reagieren.
Der Philosoph fragt: Warum gilt aber das gleiche nicht in anderen, ebenfalls massiven Krisen? Dieser Frage schließe ich mich an.
Politik reagiert hart und klar und tut alles, um eine Katastrophe zu vermeiden. Da mache ich mit, auch ich will das vermeiden. Ich will aber auch anderes vermeiden, zum Beispiel den massiven und uns gefährdenden Klimawandel.
Und die anderen Krisen?
Auch hier gibt es klare wissenschaftliche Modelle und Prognosen, wie beim Virus. Aber hier erlauben sich einige Politiker, das zu ignorieren oder gegen andere Prinzipien – Autoindustrie in Deutschland schafft Arbeitsplätze – abzuwägen. Hier richtet man sich dezidiert nicht nach naturwissenschaftlichen Einsichten und Modellen.
Oder besser: man richtet sich nach wirtschaftswissenschaftlichen Modellen, nicht nach der Klimaforschung.
Ich würde mich freuen, wenn wir in der Debatte diese Dimension nicht vergessen. In der augenblicklichen Krise traue ich der Politik zu, die richtigen Abwägungen zu treffen. Zwischen Kontaktverbot und Notwendigkeit zur Versorgung. Zwischen wirtschaftlicher Abschottung und damit Not und der Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems.
Vertrauenssache
In der anderen Krise, der Krimakrise, habe ich das Vertrauen allerdings nicht. Zu laut rufen seit Jahren die Experten mit ihrer naturwissenschaftlichen Expertise, zu langsam gibt es da Fortschritt.
Die politischen Prinzipien bleiben, und das ist gut so. Nur müssten sie auch mal auf andere naturwissenschaftliche Erkenntnisse angewendet werden. Die nächste massive Krise steht bereits an, und die wird sich nicht mit zu-Hause-Bleiben lösen lassen.