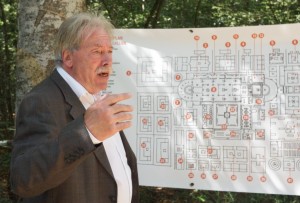Robuster hätte ich auftreten sollen. Nach meiner Einladung am vergangenen Wochenende, beim BR zu Kirche und Corona zu sprechen, habe ich eine ganze Reihe von Rückmeldungen bekommen. Die meisten lassen sich so zusammen fassen: Selbstbewusstsein tut der Kirche gut. Und dieses hätte ich vermissen lassen.
Ob das stimmt, das überlasse ich den Zuschauenden. Ich finde aber wichtig, dass wir über die richtigen Dinge sprechen. Es sind Schwächen sichtbar geworden, die vor der Krise von Gewohnheit oder Tradition noch nicht sichtbar waren. Dass sich Kirche wandelt, ist ja nicht neu. Seit Jahrzehnten sprechen Pastoraltheologen und Soziologen davon, dass es einen Traditionsabbruch gibt, dass wir weniger werden, dass die Bedeutung institutionalisierter Religion in der Gesellschaft abnimmt.
Selbstbewusstsein tut der Kirche gut. Wirklich?
Meine Reaktion darauf ist, das ernst zu nehmen. Natürlich gibt es nach wie vor starke Kirchen, lebendige Gemeinden, christlichen Einsatz. Das will ich gar nicht klein reden. Nur zeigt uns der Blick aufs Ganze einen anderen Horizont. Was ich ja auch nicht zum ersten Mal so sage.
Mein Anliegen – und das war dann auch der Tenor meiner Antworten auf einige der Emails – ist es, die Signale nicht untergehen zu lassen. Wir können lernen. Was für eine Gestalt Kirche in 20 oder 30 Jahren haben wird, kann ich auch nicht sagen. Aber ein reines Festhalten an dem, was war, wird uns nicht weiter bringen.
Was uns in Zukunft trägt
Die Energie und der gelebte Glaube können uns weiter tragen, einzeln und als Gemeinschaft, wenn wir die Realität ernst nehmen. Das ist mein Anliegen. Das ist sicherlich eher auf der nachdenklichen denn auf der robusten Seite. Aber ich finde es wichtig.
Was meinen Sie? Was sind die Dinge, die uns in die Zukunft tragen?
P.S. Der Beitrag ist leider nicht mehr in der Mediathek zu sehen. Stand: 8. Juni.