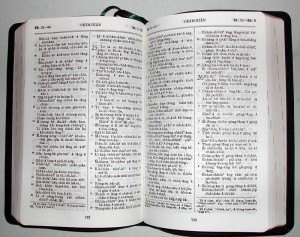Kirchensprech hat leider die Neigung, Tatsachen einfach voraus zu setzen. Wir sind gewohnt, dass von der Kanzel aus gesprochen wird. Und die Kanzel ist nicht wirklich ein Ort der Streitkultur oder der Debatte. Das hat sich nahtlos übersetzt in einige Erklärungen zu Kirche und Corona. Und das bis hin zu wirren Verschwörungstheorien ohne Grund, eben weil angebliche Tatsachen einfach behauptet werden. Das hilft gar nichts. Es braucht es einen fragenden Blick auf die Realität.
Fragen stellen ist überhaupt gut, weil man sich dann erst überhaupt mit sowas wie Realität auseinander setzen muss. Dass muss der Verschwörungstheoretiker oder der apodiktisch von der digitalen Kanzel redende Erklärer nicht. Dazu ganz frisch auf dem Tisch: Ein Projekt mehrerer Hochschulen zur Frage, wie die Kirche durch die Krise kommt. Oder in der Sprache der Wissenschaft: „Internationales, ökumenisches Forschungsprojekt zur digitalen Präsenz der Kirchen unter den Bedingungen von Versammlungsbeschränkung und Abstandsgebot während der COVID-19-Pandemie.“ Wen das interessiert, hier finden Sie den Internetauftritt.
Es braucht es einen fragenden Blick auf die Realität
Warum es diese Projekt gibt und was der Grundgedanke ist, mag ich hier nicht wiederholen, dazu gibt es ein Interview mit einem der Macher. Aber an dieser Stelle möchte ich dann doch Lob anbringen. Vor zwei Monaten hatte ich hier an dieser Stelle geschrieben, dass die Krise uns dazu bringen muss, genau hin zu schauen und für die Zukunft zu lernen. Und da war ich nun wirklich nicht der Einzige, der das so gesagt hat. Dass sich jetzt die Theologie dessen annimmt, ist wunderbar.
Als jemand, der am synodalen Weg beteiligt ist, kann ich gar nicht abwarten, was die Ergebnisse sein werden.