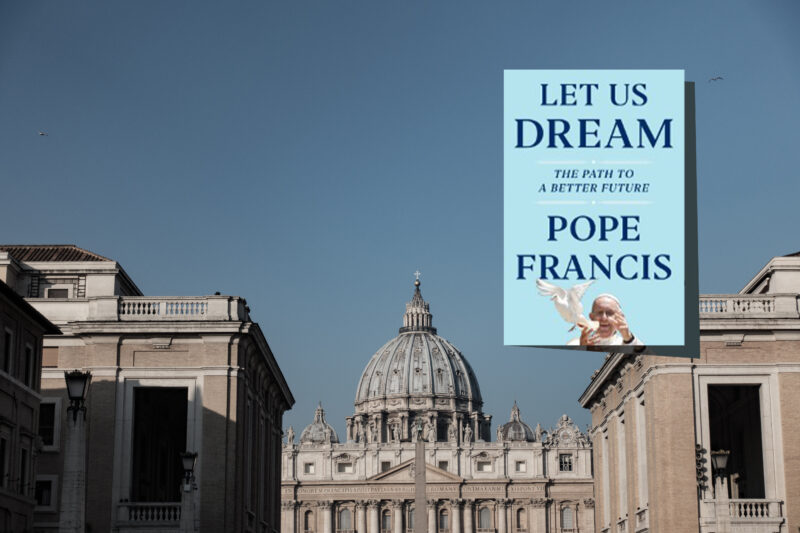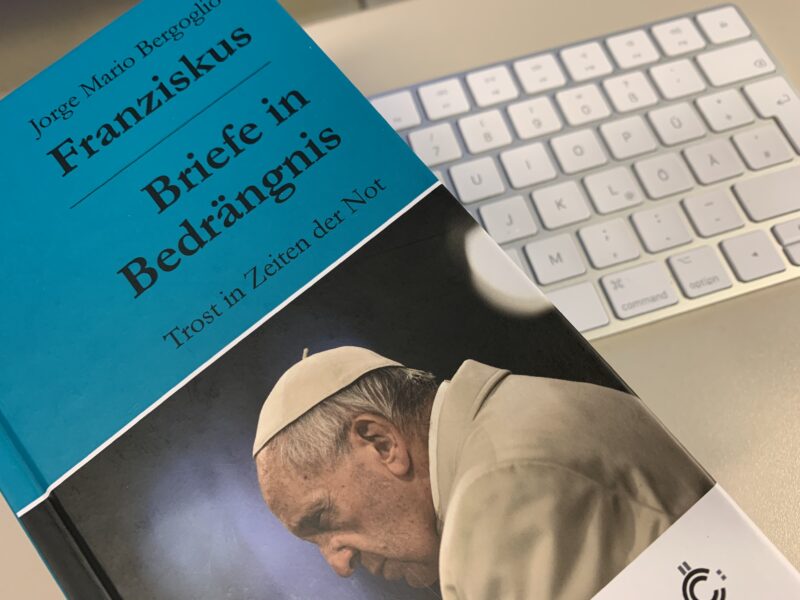Es geht um etwas, was uns übersteigt. Was größer ist. Wohin wir nur kommen, wenn wir uns zu träumen erlauben. Träumen ist keine Phantasterei, träumen bedeutet hinaufreichen, über den Horizont blicken, sich nicht von vermeintlichen Mauern einschränken zu lassen.
So etwas braucht es heute. Und deswegen hat Papst Franziskus ein Buch darüber geschrieben. Heute kommt es auf den Markt: „Wage zu Träumen! Mit Zuversicht aus der Krise.” Es ist kein Ratgeber-Buch, kein seichter Ermutiger. Es ist ein Projekt, das Großes will.
Träumen ist keine Phantasterei
Das Träumen war immer schon wichtig für diesen Papst. „Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln…“ schreibt er in Evangelii Gaudium (27). Traum ist ein Schritt zur Veränderung, zum Wandel. Traum ermöglicht. In den Augen des Papstes selbst da, wo wir das gar nicht mehr sehen. Deswegen ruft er zum Beispiel Obdachlosen zu „Hört nicht auf zu träumen!“ Das Träumen, von dem der Papst spricht, ist kein Rückzug. Kein in sich Kehren, keine Innerlichkeit. Es will zu konkretem Handeln führen.
Dieses Buch will träumen. Was aus diesem Papst aber keinen Traumtänzer macht, im Gegenteil. Träumen ist nicht etwa eine Abkehr vom Realismus. Es braucht einen geschärften und ideologiefreien Blick auf die Wirklichkeit, um träumen zu können. Und träumerisch-realistisch war auch schon die jüngste Enzyklika. Und so kommt auch der ins Buch. Manchmal holzschnittartig, immer aufrüttelnd, oft sehr persönlich.
Ein sehr persönliches Buch
Wie gesagt, es ist ein sehr persönliches Buch geworden, vielleicht das Persönlichste. Der Papst erzählt von eigenen Krisen, von Rückschlägen und seiner Krankheit und berichtet auch vom Frust, den er damals in Deutschland erlebt hat. Aber er berichtet auch von dem, was er etwa im Studium von Romano Guardini gelernt hat. Über den wollte er ja promovieren, woraus nichts wurde. Aber geprägt hat Guardini den Papst sehr: „Guardini hat mir den Wert des unfertigen Denkens gezeigt. Er entwickelt einen Gedanken, aber dann begleitet er dich nur bis zu einem Punkt, bevor er dich innehalten lässt, um dir Raum zum Nachdenken zu geben. Er schafft einen Raum, in dem du der Wahrheit begegnen kannst.“
An dieser Stelle werde ich sicherlich noch auf das Buch zurück kommen, zuerst aber vielleicht zwei Dinge. Erstens: es lohnt die Lektüre!
Aufbau gegen Widerstände
Und zweitens möchte ich einen Aufruf des Papstes heraus nehmen, den ich für bezeichnend halte: das Nehemia-Projekt. Der Papst spricht über den Propheten und das alttestamentliche Buch gleichen Namens, in dem es um den Wiederaufbau Jerusalems nach der Katastrophe geht. Um Aufbau auch gegen Widerstände von außen. Und um die Freude, die Stärke schenkt. Das ist das, was ihn an Nehemia beschäftigt und wo er Berührungspunkte zu seinem eigenen Traum-Wagnis sieht. Und so schreibt er:
„Jetzt ist der Augenblick für ein neues Nehemia-Projekt gekommen, einen neuen Humanismus, der die Aufbrüche von Geschwisterlichkeit nutzbar machen und der der Globalisierung der Gleichgültigkeit und der Hyperinflation des Individuellen ein Ende setzen kann. Wir müssen wieder das Gefühl haben, dass wir einander brauchen, dass wir eine Verantwortung für andere haben“.
Und damit wären wir auch beim Anlass des Buches: wie kommen wir aus der Corona-Krise heraus? Was wollen wir danach aufbauen? Wie unsere Welt, in der so viel zusammen gebrochen sein wird, neu gestalten? Dass Papst Franziskus mit der Art und Weise, wir wir unsere Welt vor allem wirtschaftlich geordnet haben, nicht einverstanden ist, ist kein Geheimnis. Auch aus religiösen Gründen nicht. Aber während der Papst in der Vergangenheit eher allgemein gesprochen hatte, ist es nun eine sehr konkrete und weltweite Krise, für die er eine Perspektive entwickelt.
Man kommt nicht so aus einer Krise heraus, wie man hinein gegangen ist, das ist das Mantra des Buchs. Und deswegen: „Wir brauchen die Fähigkeit der stillen Reflexion, Rückzugsorte von der Tyrannei des Dringenden.“ Wir brauchen die Fähigkeit zu träumen.
Was will der Papst mit seinem Buch?
Was will der Papst mit seinem Buch? Zunächst einmal nimmt er eine von ihm gewohnte Perspektive ein: Man sieht die Realität besser von ihren Schwachstellen aus, von der Peripherie. Das wird in der Krise besonders sichtbar. Nicht die Stärken bestimmen seinen Blick auf die Welt, sondern eben diese Schwächen.
Mit diesem Blick schaut er auf Covid, aber daneben zählt er auch die anderen Schwächen und Krisen der Welt auf, die im Augenblick in den Hintergrund gerückt sind, etwa fehlende Schulbildung für viele Kinder oder den Hunger. Seine Angst ist, dass wir alle hart daran arbeiten, den Zustand von vor der Krise wieder her zu stellen. Seine Angst ist es auch, dass das, was in der Krise sichtbar geworden ist, nachher wieder zugedeckt wird. Und so einsichtig das ist für Menschen, deren Existenz jetzt bedroht ist, so war das System von davor doch Teil des Problems. Deswegen sein Mantra: Man kommt nicht so aus einer Krise heraus, wie man hinein gegangen ist. Es ist an uns, das zu gestalten.
Das Mantra des Papstes
Und genau darum geht es in dem Buch: gestalten. Die Gleichgültigkeit und das sich nicht zum Nachbarn und Schöpfung kümmern, das seien keine Optionen mehr. Leider sei unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Welt genau darauf aufgebaut. Und geschützt werde das von einer inneren Haltung, der – wie er es nennt – „abgeschlossenen Geisteshaltung“, der er eine großen Teil des Buches widmet. Es ist eben keine abstrakte Kritik am „System“, sondern konkret, für jede und jeden handhabbar. Wir können auf uns selber schauen, wenn es um die Überwindung der Krise geht. Und das ist sein Anliegen.
Nicht „man müsste mal“, sondern ganz praktische schauen auf sich selbst und die eigene Haltung und das eigene Herauskommen aus der Krise. Natürlich hat der Papst auch wieder Wirtschaftskritik im Gepäck, das Wachstums-Prinzip sei nicht länger haltbar. Er argumentiert auch für ein Gundeinkommen und hat andere konkrete Ideen. Aber der Kern ist dann doch das, was wir geistlich als „Umkehr“ bezeichnen.
Der „Feind der menschlichen Natur“
So ist der spannendste Teil des Buchs eben die spirituelle Anleitung. Er spricht vom „Feind der menschlichen Natur“, also von dem, was uns von uns selbst, vom Nächsten und von Gott entfernt und letztlich destruktiv ist. Er macht sichtbar, wie dieser „Feind“ agiert und unser Leben beeinflusst. Er bedient sich durchweg einer spirituellen Sprache, welche die Worte Versuchung, böser Geist, Geisteshaltung und Demut kennt.
Der Schlussakkord: Wenn wir besser aus dieser Krise herauskommen wollen, müssen wir die Idee zurück gewinnen, dass wir als Volk ein gemeinsames Ziel haben. Die Pandemie hat uns daran erinnert, dass niemand alleine gerettet wird.
Das Ziel Gemeinwohl, das Ziel „träumen”
Gemeinwohl ist das Ziel, ausgedrückt in dem in unserer Sprache vielleicht etwas sperrig klingenden Wort „Volk“. Gemeinwohl ist viel mehr als die Summe des Wohls der Einzelnen. Und das ist ja aktuell, wie der Impfstoff-Nationalismus dieser Tage sehr deutlich zeigt.
„Indem wir diese Fragen stellen, öffnen wir uns für das Handeln des Geistes. Wir können beginnen zu unterscheiden, neue Möglichkeiten sehen, wenigstens in den kleinen Dingen um uns herum oder in den alltäglichen Dingen, die wir tun. Und indem wir uns diesen kleinen Dinge überlassen, beginnen wir, uns eine neue Weise des gemeinsamen Lebens vorzustellen, des Dienstes an unseren geliebten Mitgeschöpfen. Wir können anfangen, zu träumen.“
Was den Papst interessiert, sind nicht einzelne Rezepte, sondern der Prozess des Wandels. Es geht ihm religiös gesprochen um die Dynamik der Bekehrung. Um ein „Pilgern“, ein sich bewegen, ein nicht da stehen bleiben, wo man es vermeintlich behaglich eingerichtet hat und wohin man zurück will. Das geht aber nicht mehr,
Denn noch einmal: „Lange Zeit dachten wir, wir könnten in einer kranken Welt gesund sein. Aber die Krise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, für eine gesunde Welt zu arbeiten“. Wir kommen nicht aus der Krise heraus, wie wir hinein gegangen sind. Es ist an uns, das zu gestalten.