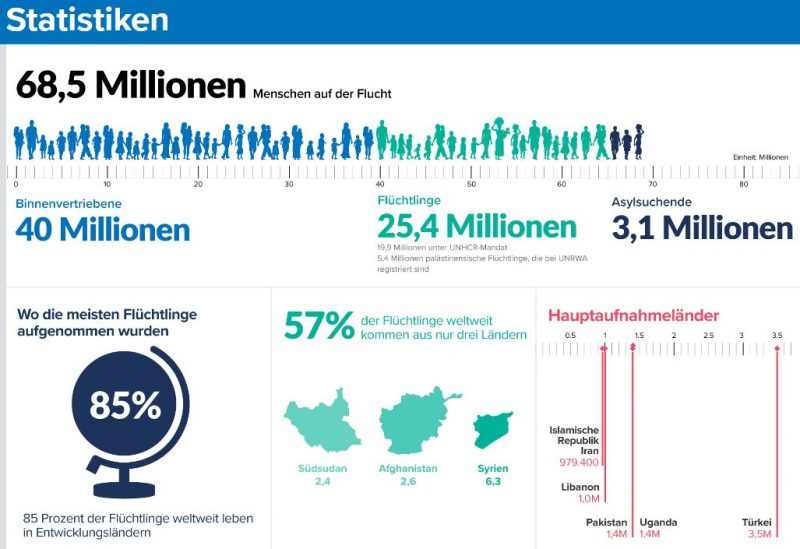So viel Politik war selten. Papst Franziskus schreibt eine neue Enzyklika, eine Sozialenzyklika, aber der Fokus liegt ganz klar auf der Politik. Oder anders formuliert: auf der gemeinsamen Verbesserung unserer Welt. Der Papst will träumen, und zwar von einer neuen Geschwisterlichkeit. Und das gemeinsam mit allen, nicht nur Christinnen und Christen. „Kann die Welt ohne Politik funktionieren? Kann sie ohne eine gute Politik einen effektiven Weg zur allgemeinen Geschwisterlichkeit und zum gesellschaftlichen Frieden finden?“ (FT 176). Nein, kann sie nicht. Also spricht der Papst über Politik.
Kern des Franziskus-Politischen ist einmal mehr der barmherzige Samariter. „Betrachten wir das Modell des barmherzigen Samariters. Dieser Text lädt uns ein, unsere Berufung als Bürger unseres Landes und der ganzen Welt, als Erbauer einer neuen sozialen Verbundenheit wieder aufleben zu lassen.“ (FT 66) Nächstenliebe ist nicht Wohltätigkeit, sondern aktiver Einsatz. Und aktiver Einsatz, politischer Einsatz, ist kein Zusatz zum Glauben, sondern gehört dazu. Er ist die Option, „die wir wählen müssen, um diese Welt, an der wir leiden, neu zu erbauen“ (FT 67).
So viel Politik war selten
Es gibt die Tendenz in einigen katholischen Zirkeln, den Rückzug und die Abgrenzung zur Welt als den Weg in die Zukunft zu sehen. Das sieht der Papst nicht so. Der Gestaltungswille ist christlich, das Miteinander auch mit anderen ist christlich, nicht die Abgrenzung. Das ist die katholische Lehre.
Nicht, dass das ein Abgleiten ins nur und rein säkular-Politische wäre, die Anker des Christlichen in der Enzyklika sind sehr stark: „An erster Stelle steht die Liebe; was nie aufs Spiel gesetzt werden darf, ist die Liebe; die größte Gefahr besteht darin, nicht zu lieben (vgl. 1 Kor 13,1-13)“. „ Die Liebe ist das Herzstück jedes gesunden und nicht ausgrenzenden Gesellschaftslebens.“ Auch Liebe ist eben nichts Privates, rein Persönliches, sondern führt auf den Anderen zu. Die Öffnung des Herzens gegenüber den Mitmenschen führt zur Öffnung des Herzens gegenüber Gott.
Liebe öffnet Herzen
Und das führt zum Engagement, zum Willen die Welt besser zu machen, kurz: zur Politik. Vorbereitet hatte er die Gedanken schon seit einiger Zeit. Aber die Enzyklika behandelt nicht nur katholische Soziallehre. Sondern wendet sich vielmehr dem Warum und dem Wie zu. Vor allem: dem gemeinsamen Handeln.
Das Ganze ist ja in der Vergangenheit oft genug schief gegangen. Der Papst nennt die Corona-Krise, aber viel bedeutsamer finde ich die Finanzkrise von 2008, bei der das gemeinsame Scheitern schon sichtbar wurde. Und das ist dem Papst nun Anlass, nach neuen Wegen zu suchen.
Und der führt über das Naturrecht. Diesen Weg waren schon seine Vorgänger gegangen, von allem Benedikt XVI. in seiner Rede vor dem Bundestag. Bei Franziskus klingt das so: „In der Wirklichkeit des Menschen und der Gesellschaft selbst, in deren innerster Natur, gibt es eine Reihe von Grundstrukturen, die ihre Entwicklung und ihr Überleben sichern. Daraus leiten sich bestimmte Forderungen her, die im Dialog entdeckt werden können“ (FT 212). Und dann der Zusatz: „Für Gläubige ist die menschliche Natur als die Quelle ethischer Prinzipien von Gott geschaffen“.
Im Dialog erkennen wir Werte
Ganz wichtig: das neue „Wir“ und die gemeinsamen Werte entstehen nicht über einen falschen Konsens. Nicht über eine Toleranz, die einfach nur in einem Verschonungspluralismus alles nebeneinander gelten lässt. Über den Dialog lassen sich Werte wie Geschwisterlichkeit erkennen, weil sie eben in uns drinnen liegen.
Andersherum formuliert: der falsche Konsens und die falsche Toleranz spielen den Mächtigen in die Hände. „ Der Relativismus ist keine Lösung. Unter dem Deckmantel von vermeintlicher Toleranz führt er letztendlich dazu, dass die Mächtigen sittliche Werte der momentanen Zweckmäßigkeit entsprechend interpretieren.“ (FT 206)
Erst der Blick auf das Menschsein und auf unsere Geschwisterlichkeit ermöglicht die Kritik der Machtverhältnisse und der Ausübung von Macht. Das ist eine Aufgabe für die Glaubenden. Und es ist eine Aufgabe auch für die Kirche als solche: „ Aus diesen Gründen respektiert die Kirche zwar die Autonomie der Politik, beschränkt aber ihre eigene Mission nicht auf den privaten Bereich. Im Gegenteil, sie kann und darf beim Aufbau einer besseren Welt nicht abseits stehen, noch darf sie es versäumen, die seelischen Kräfte zu wecken, die das ganze Leben der Gesellschaft bereichern können.“ (FT 276)
Kritikfähigkeit
Der Papst kritisiert deutlich die Marktgläubigkeit und eine Finanzwirtschaft, die außerhalb politischer Kontrolle agiert.
Der Papst betont, dass Privateigentum kein absolutes, sondern ein sekundäres Recht des Menschen ist.
Der Papst fordert ganz realistisch eine Reform der internationalen Organisationen, allen voran der UNO.
Der Papst demaskiert die Menschenverachtung der Demagogie. „Wir müssen uns angewöhnen, die verschiedenen Arten und Weisen der Manipulation, Verzerrung und Verschleierung der Wahrheit im öffentlichen und privaten Bereich zu entlarven.“ (FT 208)
Der Raum der Mitverantwortung
Vielem von dem werde ich mich hier sicherlich noch im Einzelnen zuwenden. Diese kurze Aufzählung ist aber wichtig, um die Breite des Spektrums der Enzyklika aufzuzeigen. Vor allem ist es wichtig zu betonen, dass das uns alle angeht: „Wir dürfen nicht alles von denen erwarten, die uns regieren; das wäre infantil. Wir genießen einen Raum der Mitverantwortung, der es uns ermöglicht, neue Prozesse und Veränderungen einzuleiten und zu bewirken. Wir müssen aktiv Anteil haben beim Wiederaufbau und bei der Unterstützung der verwundeten Gesellschaft. Heute haben wir die großartige Gelegenheit, unsere Geschwisterlichkeit zum Ausdruck zu bringen; zu zeigen, dass wir auch barmherzige Samariter sind.“ (FT 77)
Die Welt ist in einem schlechten Zustand. Machen wir sie besser, weil das Gottes Wille für uns ist.