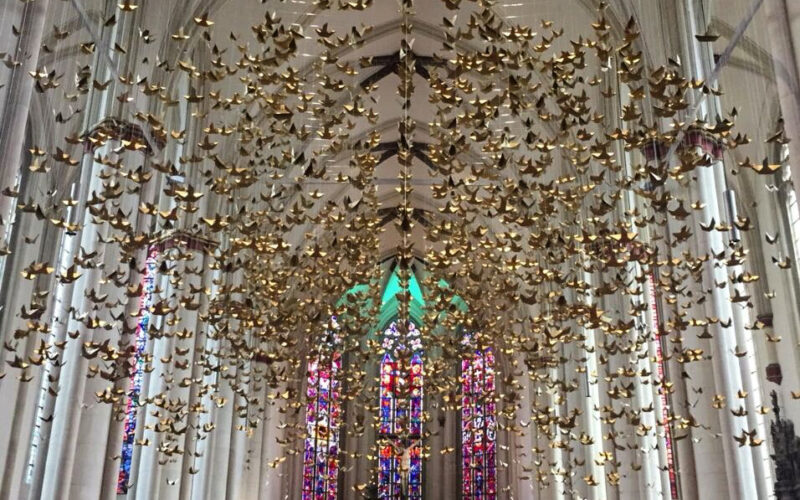Ein Schnappschuss aus der bunten Welt der Kirche: am Samstag flatterte mir der Newsletter von CruxNow auf den Rechner, darin zwei Meldungen nach deren Lektüre ich aus dem Kopfschütteln nicht heraus komme. Es ist, als ob mir Artikel aus zwei grundverschiedenen Zeitungen gleichzeitig vorgelesen werden. Synodalität, gleichzeitig Ja und Nein.
Da ist zum einen eine Serie über den Synodalen Weg. Ob der ins Schisma führe, wird gefragt. Alle Artikel, die differenziert nach dem Weg fragen, vor allem im nicht-deutschsprachigen Teil der Welt, finde ich gut.
Gleichzeitig Ja und Nein
Hier wird das Schisma-Thema ausgefaltet, die Bemerkung von Kardinal Marx, die Kirche in Deutschland sei keine Unterabteilung der Kirche in Rom, wird als Indikator einer Gefahr gesehen. Der Tenor des Artikels: „Warnung“. Und es kommen vor allem Warner zu Wort. Darunter zu meinem Erstaunen ich selber.
Da ist zum anderen aber auch ein Artikel über Schwester Nathalie Becquart, die seit kurzer Zeit im Vatikan für die Bischofssynode arbeitet. Ich hatte sie mal während der Jugendsynode kennen gelernt, eine kluge Frau voller Energie und Ideen. Und hier nun darf sie für Syodalität werben, auch wenn es unangenehm werde und einen Wandel in der Leitungskultur bedeute.
Warnungen
Sie warnt auch, allerdings vor dem Widerstand gegen den Wandel. Und der Artikel folgt ihr darin.
Da haben wir nun zwei Stücke nebeneinander, die widersprüchlicher nicht sein können. Wandel und Warnung davor, die vatikanische und auch päpstliche Rhetorik für Synodalität, aber bitte nicht ausprobieren, denn dann könnte ja was passieren.
So etwas kann in einer Redaktion schon mal passieren, aber als Schnappschuss gilt es weit über CruxNow hinaus, es gilt für die ganze Kirche.
Es hat halt Konsequenzen
Gesprochen wird viel, auch gewollt. Nur die Konsequenzen, die will man nicht. Man bleibt in Appellen, in Wünschen, in Visionen, die Unruhe des Ausprobierens und der Umsetzung fürchtet man, davor warnt man lieber. Man kann aber nicht gleichzeitig etwas wollen und gleichzeitig nicht wollen. Etwas gut finden und vor der Umsetzung warnen. Das Ideal hoch halten und die Realität desselben fürchten.
Wandel hat Konsequenzen. Bekehrung der Kirche hat Konsequenzen. Das muss man ausprobieren und mit Hilfe des Geistes Gottes real werden lassen. Nicht immer wird alles gut und perfekt, aber ohne es zu probieren, bleibt es nur Prosa. Und probieren, bei allen Problemen, will der Synodale Weg.