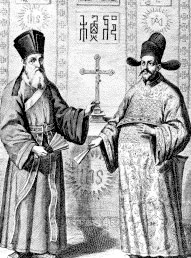Er war Gemeindeleiter, als Laie. Aber sie als Ehefrau und Mutter war immer dabei. Seelsorge und Gemeindeleitung durch Laien geht nur gemeinsam, als Paar. Seelsorge zu zweit, sozusagen. Oseas Araújo Pereira hat die Ausbildung und Begleitung, seine Frau Maria-Clara wusste von Anfang an, dass sie das alles mit heiraten würde.
Zu Anfang sei es „nur“ kirchliches Engagement gewesen, damals als Oseas noch für eine Baufirma gearbeitet habe, erzählt Maria-Clara bei unserem Besuch. Beide seien kirchlich engagiert gewesen, das war immer Teil beider Leben.
Seelsorge zu zweit
Dann aber habe Oseas als Gemeindeleiter gearbeitet, in einem Projekt des Bistums Itaituba, weil es so wenig Priester gibt und Seelsorge und Gemeindeleitung durch Laien gefördert werden sollte. „Gerade hier in der Stadt ist die Barriere spürbar zwischen einem Priester und einem Laien, da merke ich schon dass ich kein Priester bin. Die Leute haben mich das auch spüren lassen. Aber draußen, etwa bei den Goldsuchern, ist das schon anders, die sind froh, wenn da jemand kommt und mit ihnen über das Wort Gottes spricht. Da gab es diese Barriere nicht“, so berichtet Oseas.
„Für mich war diese intensive Zeit sehr wichtig, vor allem war mir wichtig, dass ich von meiner Familie begleitet und unterstützt worden bin. Das hat mich gestärkt, und die mussten das auch mittragen, wenn ich mal wieder einige Tage unterwegs war.“
Familie in der Seelsorge
Ein Nicken von seiner Frau Maria-Clara, seit die Tochter vier war, seien sie fast immer gemeinsam unterwegs gewesen, aber „Wenn es mal Zeiten gab, in denen wir zu Hause bleiben mussten, habe ich mir immer gesagt dass da gerade Menschen sind, die ihn vielleicht dringender brauchen als die eigene Familie.“
Dringender als die eigene Familie? Das sagt mehr über die außergewöhnliche Situation der Familie aus als alles andere. „Die Zeit hier in Morais Almeida war die beste Zeit, die wir beide in dieser Hinsicht hatten, auch für mich selbst, persönlich. Ich habe hier bereichernde und religiöse Erfahrungen machen können, über die Arbeit in der Gemeinde. Das ging weit über das hinaus, was ich bis dahin für Religion und Glauben gehalten hatte“, das sagt sie im Rückblick auf die vier Jahre als Gemeindeleiter und in der „Seelsorge zu zweit“.
Nicht einfach, Gemeinden und Pfarrer zu überzeugen
Damit ist es aber leider vorbei, denn zum einen war es nicht einfach, die Gemeinden von Laien-Leitung in der Kirche zu überzeugen, „verheirateter Pater!“ hätten sie ihn genannt, sagt Oseas. Außerdem habe immer alles von Priestern abgehängt, jetzt die Gemeinden zu überzeugen, selber etwas zu tun und auch finanziell etwa zu Reisekosten beizutragen, sei fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die Gemeinden wollten Priester! Die Zentrierung aufs Klerikale hat auch im Regenwald Spuren hinterlassen.
„Der Laiendienst war und ist akzeptiert, aber ich habe das Gefühl, dass es da Grenzen gibt. Im Bistum sehe ich nicht das Problem, die wollen Laien und Priester in Zusammenarbeit. Aber vor Ort ist das immer anders“, sagt Oseas. Das sei auch bei den Pfarrern so, mit denen er zusammengearbeitet habe, zumindest einigen. „Es stimmt, erst wird man angeregt, sich zu engagieren, aber dann spannt die Kirche die Zügel an und hält einen zurück. Die Kirche zentralisiert, und da gibt es Angst, Macht zu verlieren.“ Das sei einer der Gründe, weswegen jetzt nicht mehr in der Gemeindeleitung dabei sei.
Er selber habe nie ein verheirateter Priester sein wollen, Viri Probati und dergleichen sieht er als keine Option für sich, da ist Oseas klar. Aber wenn nur diese kleinen alltäglichen Klerikalismen überwunden werden könnten, dann wäre man schon sehr viel weiter.