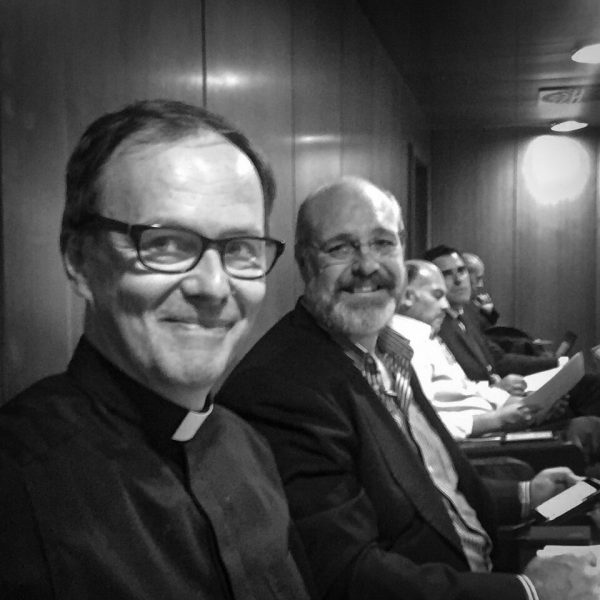In zwanzig Jahren ist alles vorbei. Ein Interview eines Historikers zum Thema Epochenwandel der katholischen Kirche zog in den vergangenen Tagen im Netz seine Bahn, vor allem eng geführt auf Kardinal Woelki und die Vorgänge in Köln.
Dabei beschreibt Prof Kaufhold einen Wandel, der über aktuelle Krisen hinaus geht. Oder der diesen zu Grunde liegt, wie man will. Die Sonderrolle des Klerus als Heilsvermittler schwinde.
Epochenwandel der katholischen Kirche
Der Synodale Weg und überhaupt alle derzeitigen Debatten in der Kirche mögen von Missbrauch und dem – mangelhaften – Umgang damit geprägt sein, der Epochen-Bruch, den der Historiker Kaufhold skizziert, erinnert aber an den grundlegenden Gestaltwandel der Kirche.
Kurz: nichts wird mehr so sein wie früher.
Wir mögen das an Kirchenmitgliedszahlen oder besser noch Austrittszahlen fest machen. Oder an Pfarreireform. An Nachwuchsmangel. Woran auch immer, Kirche ändert sich. Und kein Synodaler Weg, aber auch kein Beharren auf dem Vergangenen wird daran irgendwas ändern. Wir müssen lernen, diesen Wandel zu gestalten.
Wandel gestalten
Und sind – jedenfalls was die Leitung angeht, so Kaufhold – nicht besonders gut darin. Die Gestaltung dieses Wandels laufe fatal, deswegen die Prognose der zwanzig Jahre, die es diese Kirche noch geben wird. Fatal, weil man als Klerus schon irgendwie das Neue will, aber am Alten festhält.
Zitat aus dem Interview in der Augsburger Allgemeinen: „Nehmen Sie nur das hilflose Konzept der sogenannten Neuevangelisierung, auf das die Kirche baut. Da stellt sich der Eindruck ein: Die Gläubigen machen etwas falsch – und der Klerus müsse ihnen beibringen, wie es richtig geht.“ Das ist nur ein Beispiel, das wäre austauschbar. Man mag das nun Klerikalismus nennen oder nicht, das Phänomen ist bekannt.
Klerus bringt bei, wie es richtig geht
Gestaltung geht anders. Nur ein Beispiel: bei einer internationalen Tagung zum Thema Priester sagte der immer wieder inspirierende Tomas Halik, dass es in Zukunft viele Weisen geben werde, Christin und Christ zu sein. Also müsse es auch verschiedene Wege geben, Priester zu werden. Und er zitiert den Apostel Paulus: Diener der Freude der Menschen solle ein Priester sein. Das ist weit weg vom Vollmachtträger des Heiligen, der irgendwie über das allgemein Menschliche Glauben hinaus ragt.
Das oben erwähnte Interview ist noch aus einem anderen Grund interessant. Es weist auf die ‚Sorge um das eigene Seelenheil‘ hin, das vor etwa 1.000 Jahren am Anfang der gegenwärtigen Form des Priesterseins gestanden habe. Sehr generell formuliert, aber wichtig ist nun einmal der Priester als Vermittler des Heiligen. Er hat eine sakrale Aura, oft überhöht, und Exklusivität.
Vermittler des Heiligen
Deswegen ist es so wichtig, dass auch im Synodalen Weg über Formen des Priesterlichen gesprochen wird. Das ist nicht nur ‚priesterliche Lebensform‘ im soziologischen Sinn, daran hängt auch die Frage, welche Rolle ein Priester im Glauben der Menschen haben soll.
Priester als Pfarrer, oft überdehnt durch die schiere Menge an Gemeinden oder die zurück zu legenden Kilometer. Priester wie ich, die etwas ganz anderes machen als Gemeindearbeit. Priester als Leiter von Gemeinden, am Altar und in der Beichte, das alles sind Scharnier-Fragen von dem, was Kirche in Zukunft sein will.
Es gilt eben nicht mehr das „Die Gläubigen machen etwas falsch …“. Es braucht eine neue Zuordnung des Priesterlichen zum Glauben der Einzelnen. Und der Gemeinde.
Das Paulus-Zitat finde ich wunderbar für jede Debatte über das Priesterliche, überhaupt für jeden Dienst in der Kirche. Deswegen abschließend der ganze Satz aus 2 Kor 1:24:
„Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude; denn im Glauben steht ihr fest.“