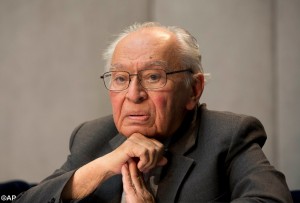Nach dem Katholikentag ist vor dem nächsten. Oder zumindest mitten in den Überlegungen, wie es weiter gehen kann und soll. Neben allem möglichen Lob gab es und gibt es auch kritische Stimmen, anmerkende und vorschlagende, aber auch klarere und deutlichere Kritik. Alles gehört dazu. Schließlich gab es und gibt es auch ganz grundsätzliche, und eine solche möchte ich hier aufgreifen, einen Artikel unter der Überschrift „Schamlos Paternalistisch“. Schon der Titel gibt hier die Musik vor.
Mit etwas Abstand bietet der Autor Christian Geyer in seinem Artikel in der FAZ seine Analyse an. Der Kern dieser Überlegungen ist eine „inklusive Gottessuche“, ich übersetze das für mich als ein Denken und Reden von Gott in der Welt, das auf möglichst große Breite setzt. In den Worten des Autors: Wer gibt nun wem das Maß vor, die Welt der Kirche oder umgekehrt? Papst Benedikt XVI. hat in seinem Sprechen von der „Entweltlichung“ einen Vorschlag gemacht, der Autor hier geht aber einen anderen Weg. Er wendet sich dem Theologisieren zu. Wie ist die Sache mit Gott und den Menschen zu sehen? (Ich benutze hier „theologisieren“ bewusst nicht im akademischen Zusammenhang, sondern weiter, als das reflektierende und reflektierte Sprechen und Suchen nach Gott)

Was Theologie zu sein hat, kann man ganz gut in einer Kritik an besagtem Artikel entdecken. So vereinnahmt der Autor gleich ganze Kontinente gegen den Papst („die afrikanischen, nordamerikanischen und viele asiatische Bischöfe“). Man sei verstimmt, spätestens seit der autoritativen Führung der Synode. Wenn ich selber während der Synode Kritik gehört habe, dann die, dass der Papst zu wenig das Heft in die Hand genommen und zu viel auf Prozess gesetzt habe. Und selbst wenn es die andere Kritik auch gibt, eine derartige Vereinnahmung ist grob und schädigt letztlich das Argument. Deswegen kann man sagen: Theologie muss im Gegensatz zu den Thesen im Artikel differenzieren. Nicht über einen Kamm scheren. Oder wie mein erster Theologie-Lehrer sagte: Der Teufel liegt im Detail, Gott auch. Das etwas grob geschnitzte und deswegen fehl gehende Argument des Kontinente übergreifenden Aufbegehrens gegen die Theologie des Papstes verführt, erklärt aber nichts.
Auch mal prophetisch sein
„Es gibt eine gesellschaftliche Suchbewegung nach Alleinstellungsmerkmalen“ sagt Geyer weiter und wendet diesen Satz gegen das theologische Sprechen von der Inklusion. Erstens ist diese Suche zunächst noch wertneutral. Sie kann auch kräftig nach Hinten losgehen, die Wirklichkeiten verachten, ein sich Abschließen von Realität sein. Kann, nicht muss. Das nur als Bedenken. Theologisches Sprechen bedeutet hier eben, auch mal dagegen zu sein. Prophetisch wäre vielleicht schon zu stark, aber man muss den Geist der Zeit auch hier unterscheiden und feststellen, wo man mitgehen kann und wo man widersprechen muss, mit Blick auf den eigenen Glauben und auf Jesus Christus.
Das „Begehren“ nach Christus führt nämlich genau nicht zu Ausschluss, und wenn der Autor einen Jesuiten zitiert, dann tue ich das auch: „Die Welt ist Gottes so voll“, sagt Alfred Delp. Wenn man sich entschieden hat, Gott zu suchen und diese Entscheidung auch in seinem Leben durch trägt, dann lernt man, Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden. Das ist keine Verwässerung des Gottesgedankens, das ist eine geistliche Präzisierung der Suchbewegung. Nicht alles ist deswegen gleich gut, Sünde bleibt Sünde, aber im Erkennen der Sünde erkenne ich eben auch den vergebenden Christus.
Der Artikel ist letztlich ein Plädoyer für „kirchliche Identität“. Das hat durchaus einen taktischen Zug: „Der Markenkern der Kirche wird unscharf, wenn sie ihre Marketingstrategen „Ecce homo“ mit „ja zur gesamten Wirklichkeit des Menschen“ übersetzen lässt.“ Markenkern, das ist so ein Begriff, der irgendwie modern klingt, aber einen Gedanken ins theologische Reden einführt, der da eigentlich nichts zu sagen hat. Kirche ist nicht um ihrer selbst willen Kirche, sondern um Gottes und der Menschen willen. Das Volk Gottes ist nichts in sich, es ist Volk Gottes, weil es als solches gerufen und berufen ist.
Wir könnten der Kirche gar keine Identität geben, selbst wenn wir uns noch so sehr bemühten. Das kann nur Christus. An uns bleibt es, in der menschlichen Wirklichkeit zu entdecken, wo wir seinen Auftrag erfüllen und seine Kirche aufzubauen helfen und auf seine Stimme hören können. Das geht nur durch das Hören, das geht nicht durch Alleinstellungsmerkmal und Markenkerne.