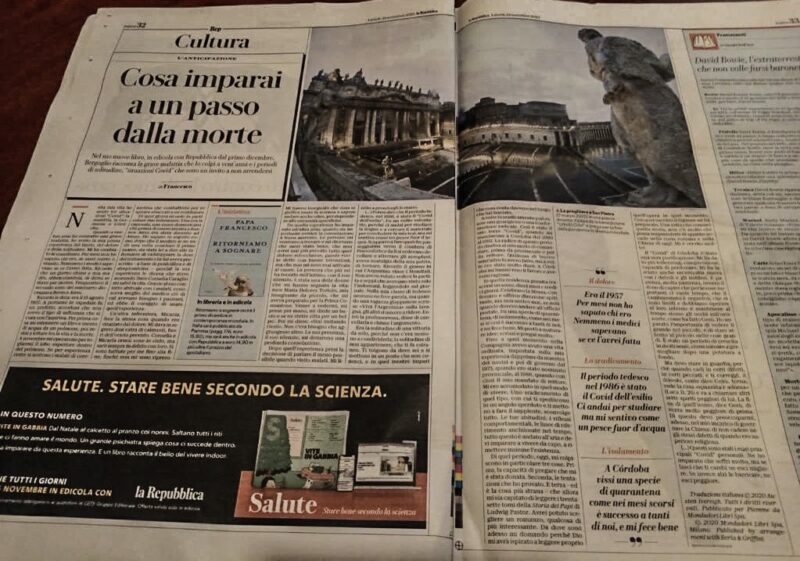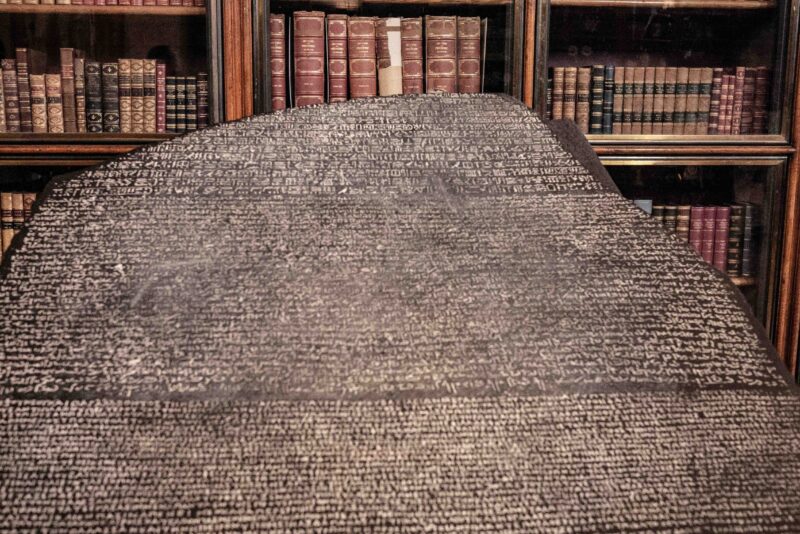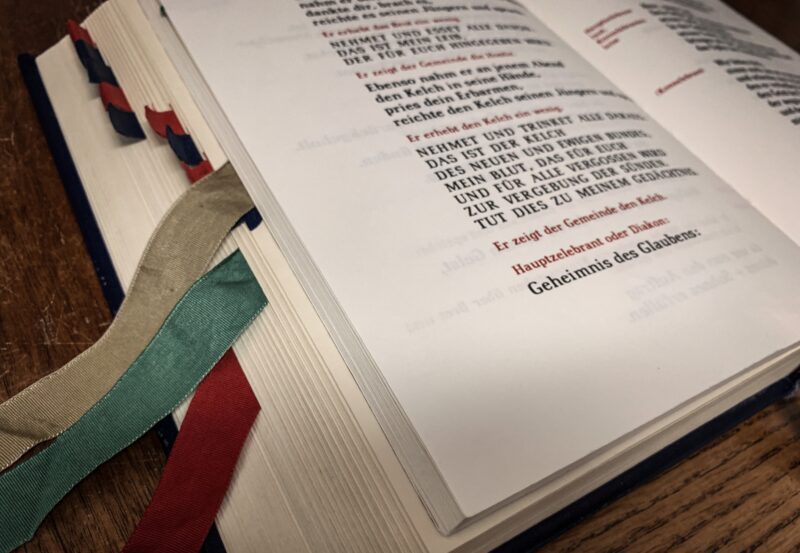Krisen lösen etwas aus. Und wenn wir aufmerksam sind, dann können wir aus ihnen etwas lernen. So in etwa die Kurzversion von den ersten Gedanken aus dem kommende Woche erscheinenden Papstbuch zu Corona. Gestern – Montag – gab es einen ersten Vorabdruck in der italienischen Tageszeitung La Repubblica.
Die Aufmachung ist schon mal dramatisch: „Was habe ich gelernt, als mir der Tod vor Augen stand?“ titelt die Zeitung. Und auch wenn es nicht wirklich der Zielrichtung des Buches entspricht sondern eher dem Verkaufswillen der Herausgeber, so macht das doch eines klar: es geht um viel.
Papstbuch zu Corona
Franziskus berichtet sehr persönlich über eigene Krisen, über die Krankheit seiner Jugend zum Beispiel. Aber auch über die Entwurzelung, die er in Deutschland erlebt hat. Alles Krisen, die ihn haben nachdenken lassen. Und das sei bei Covid genauso. Die Krise kann uns zum Beobachten und Nachdenken bringen. Dazu will das Papstbuch jedenfalls anregen, dazu mehr, wenn es auf dem Markt ist. Wen das jetzt schon interessiert, können Sie hier schon mehr lesen.
Aber ohne dem Papst zu nahe zu treten: wir können uns unsere eigenen Gedanken machen. Die Debatten der ersten Welle zu Gottesdiensten und Seelsorge etwa können wir nun mit unserer Erfahrung noch einmal führen, in Österreich noch dringender als in Deutschland. Drei Punkte möchte ich nennen, die wir da wichtig erscheinen.
Nicht kritiklos
Erstens: Verantwortlichkeit, aber nicht kritiklos. Die meisten Christinnen und Christen handeln verantwortlich, auch was Gottesdienste und etwa Besuche im Krankenhaus angeht. Aber das ist nicht gleichbedeutend mit Kritiklosigkeit. Demokratisch geführte Debatten sind zunehmend wichtig. Ein Beispiel: Der Theologe Jan Heiner Tück kritisiert die Entscheidung der Bischöfe Österreichs, das Aussetzen von Gottesdiensten mitzumachen. Das hebelt die Verantwortlichkeit nicht aus, belebt aber die Debatte.
Zweitens: aus der ersten Welle lernen. Wir haben im Sommer emotional wohl die falschen Schlüsse gezogen: es sei vorbei. Jedenfalls ist es mir so gegangen. Mein Kopf war auf eine zweite Welle vorbereitet, aber innerlich gab es da doch die Haltung, dass das jetzt doch wohl vorbei sei. War es aber nicht. Vor allem was die Notwendigkeit sozialer Kontakte angeht, haben wir lernen können. Alte Menschen, Alleinerziehende, Kinder, das kann man nicht einfach abschalten. Auch der Primat der Wirtschaft gilt nicht mehr so unausgesprochen selbststündlich, so hart das für die Betroffenen auch ist.
Drittens: über den Tellerrand hinaus blicken. Hier finde ich wird es spannend. Auch wenn jetzt alle mächtigen Länder davon sprechen, den entwickelten und produzierten Impfstoff gerecht zu verteilen – mit der selbstverständlichen Ausnahme von Präsident Trump – wird sich in der Praxis zeigen, ob unsere Gesellschaften dazu wirklich den Mumm haben. Und ob wir dazu wirklich groß genug denken und fühlen.
Über den Tellerrand hinaus
Vor allem Letzteres wird dem Papst wichtig sein. Man muss nicht in die Glaskugel schauen um zu wissen, was Franziskus besonders am Herzen liegt. Und das sieht er auch in der von Corona verursachten Krise. Es benutzt die Krise nicht für seine Themen, aber er sieht in der Krise Anzeichen, dass wir ein Umdenken brauchen. In der Wirtschaft. In der Gesellschaft. Zwischen uns. In uns.
Seien wir gespannt auf die Lektüre.